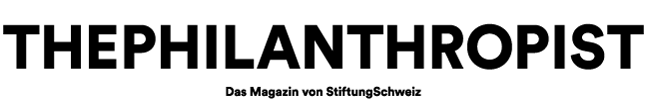Michel Mayor hat 1995 zusammen mit Didier Queloz den ersten Planeten ausserhalb unseres Sonnensystems entdeckt, 51 Pegasi b. 2019 wurden beide dafür mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Michel Mayor erzählt, wie es dazu kam.
1995 haben Sie mit Didier Queloz den ersten Planeten ausserhalb unseres Sonnensystems entdeckt. War Ihnen die Tragweite sofort bewusst?
Die Geschichte der Entdeckung beginnt eigentlich bereits 1971. Mit einem Forscherkollegen aus Marseille habe ich einen Spektrographen für ein Teleskop entwickelt. Mit diesem Gerät lässt sich mit Hilfe der Wellenlänge des Lichts die Geschwindigkeit von Sternen bestimmen. Es gelang uns, die Bestimmung 4000fach effizienter zu machen als dies bis zu diesem Zeitpunkt möglich war. Ende der 80er Jahre bauten wir dann eine neue Generation des Gerätes. Dazu nutzten wir die damals neuste Technologie. Und damit konnten wir die Präzision ein weiteres Mal um das 20fache erhöhen.
Das bedeutet?
Statt auf 300 m pro Sekunde waren unsere Messungen nun auf 15 m pro Sekunde genau. Diese erweiterten Möglichkeiten des Gerätes bewegten uns dazu, unsere Forschung anzupassen. ass ein Gerät die Forschung bestimmt, ist typisch. Anfang der 90er Jahre beschlossen wir, nach Planeten zu suchen.
Wie gingen Sie vor?
Wir selektierten 142 Sterne, die unserer Sonne ähnlich sind. Dann begannen wir der Reihe nach die Geschwindigkeit jedes einzelnen dieser Sterne zu messen. Eine Woche später wiederholten wir die Messung. Wir fanden stabile und veränderliche Sterne. Und wir fanden Stern 51 Pegasi mit einer periodischen Variation, also den Hinweis auf einen Planeten, der um diesen Stern 51 Pegasi kreist. Ende 1994 hatten wir dazu zwölf Messungen. Das war noch nicht wirklich viel. Wir waren noch etwas unsicher, was das bedeutet. Unsere Zweifel betrafen nicht die Messdaten sondern die physikalische Interpretation.
Wie forschten Sie weiter?
Es dauerte sechs Monate, bis der Stern wieder am Himmel erschien. Im Juli 1995 massen Didier Queloz und ich im Observatorium in der Haute Provence dieselbe periodische Variation. Da begannen wir zu glauben, dass wir einen Planeten ausserhalb unseres Sonnensystems entdeckt hatten. Wir entschieden uns, einen Artikel für das Wissenschaftsmagazin Nature zu verfassen. Wir waren überzeugt, unsere Entdeckung war interessant. Aber sie war auch extrem abnormal.

Inwiefern?
Der Planet braucht für einen Umlauf um den Stern 4,2 Tage. Das gibt es in unserem Sonnensystem nicht. Zu dieser Zeit sagte die Theorie, dass ein Riesenplanet mindestens zehn Jahre für seine Umlaufbahn braucht. Jupiter, ein vergleichbarer Gasriese, braucht elf Jahre. Das ist ein Unterschied mit Faktor 1000. Das ist kein Detail. Deswegen waren wir etwas unruhig. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir auch keine Erklärung, weshalb es einen Planeten mit einer so kurzen Umlaufzeit gab. Aber wir hatten alle Alternativen ausgeschlossen. Wir hatten sogar einen amerikanischen Kollegen gefragt, unsere Ergebnisse zu kontrollieren — ohne dass wir ihm die genauen Koordinaten gegeben hätten.
Weshalb diese Zurückhaltung?
Damals waren verschiedene Teams auf der Suche nach Planeten. Sie wären glücklich gewesen zu erfahren, wohin sie ihr Teleskop richten müssen.
Und was ergab die Überprüfung?
Der Kollege liess seine Maschinen zwei Tage lang rechnen. Dann kam die Bestätigung. Auf der einen Seite waren wir damit sicher, auf der anderen Seite bleibt immer ein Zweifel. Wir haben uns schon gefragt, begehen wir mit der Publikation eine Dummheit? Auch Nature war übrigens vorsichtig.
Wie haben sie reagiert?
Sie haben unseren Artikel an drei Referenten geschickt zur Prüfung. Das sind mehr als normal.
Waren Sie sehr nervös bis zur Publikation?
Am 25. August 1995 reichten wir den Artikel bei Nature ein. Anfangs Oktober wollte ich unsere Resultate auf einer Konferenz in Florenz vorstellen, noch vor der Publikation. Deswegen rief ich kurz vorher den Herausgeber an. Ich dachte, wenn ein Referent die Arbeit als Dummheit bewertet hätte,wäre es hilfreich gewesen, dies vor der Konferenz zu wissen. Als Antwort erhielt ich jedoch die Erinnerung, dass ich keine Erkenntnisse vor der Publikation in Nature veröffentlichen dürfe. Aber natürlich sei es möglich, dass ich mich mit Kollegen auszutausche. An der Konferenz in Florenz nahmen 300 Kolleginnen und Kollegen teil. Aber auch Medienschaffende. Der Organisator sagte mir, er könne ihnen nicht untersagen, dabei zu sein. Und so hat sich die Meldung von unseren Resultaten rasend schnell verbreitet. Sofort brach der mediale Wahnsinn los. Zurück im Hotel hatte ich Nachrichten – damals noch Fax – von verschiedenen grossen US-Medien. Wir hatten die Kontrolle verloren.
War das schwierig?
Ich beklage mich nicht. Didier und ich, wir haben uns gesagt, das passiert jetzt einmal. In zwei Monaten spricht niemand mehr davon.
Und?
Es hat nicht aufgehört. Im Folgejahr haben die Amerikaner weitere Planeten gefunden. Auch wir haben weitere, immer kleinere entdeckt. Jedes Mal hat es die Debatte neu lanciert.
Der Planet ist 50 Lichtjahre entfernt. Fühlt sich das wie ein Blick in die Vergangenheit an?
Nein. Der Planet ist ein Nachbar. Wenn man Galaxien studiert, die vier oder fünf Milliarden Lichtjahre entfernt sind, hat das eine andere Bedeutung.
Auch die US-amerikanischen Wissenschaftler Geoffrey Marcy und R. Paul Butler haben Ihre Entdeckung schnell bestätigt. Die beiden waren selbst auf der Suche.
Nach unserer Ankündigung richteten sie ihr Teleskop sofort auf den Stern und bestätigten unsere Arbeit. Ihr Problem war, sie hatten diesen Stern nicht in ihrer Selektion. Eigentlich hatten sie mit ihrer Arbeit mehrerer Jahre Vorsprung, Sie hatten bereits fünf Jahre verschiedene Sterne vermessen, aber nicht die Geschwindigkeit dieser Objekte. Weil Riesenplanete mehrere Jahr für einen Umlauf benötigen glaubten sie, wir können sie nicht einholen. Sie hatten nicht damit gerechnet, dass es einen Planeten mit einer derart kurzen Umlaufzeit gibt.
Dachten Sie damals an den Nobelpreis?
Dass wir unsere Arbeit in Nature veröffentlichten, zeigt, dass wir sie für interessant hielten. Aber ich hab nie an den Nobelpreis gedacht. Allerdings hat mir damals der Arzt meiner Frau gesagt: «Dafür erhalten sie den Nobelpreis».
2019 haben Sie ihn erhalten. Wo haben Sie die Nachricht erhalten?
Ich war beim Babysitten in Spanien. Mein Sohn und seine Frau waren an eine Hochzeit eingeladen und sie fragten mich, ob ich nicht mitkommen wolle, um auf die Kinder aufzupassen.
Dort haben Sie es erfahren?
Es war 15 Minuten bevor ich auf den Flughafen fahren musste, um an eine Konferenz in Madrid weiterzureisen. Im Internet hörte ich, wie die Akademie bekannt gab, dass drei Wissenschaftler für die Erforschung unseres Kosmos ausgezeichnet werden. Interessant, dachte ich. Dann nannten sie als ersten James Peebles. Wieder ein Kosmologe, dachte ich. Und dann hiess es, dass auch zwei Forscher ausgezeichnet würden, die den ersten Planeten ausserhalb des Sonnensystems entdeckt hatten. Mit der Akademie diskutierte ich dann am Flughafen an der Bar über meinen Laptop. Als wir in Madrid gelandet waren, warteten bereits die Journalisten – und als ich wieder zu Hause war, stand hinter der Tür eine Flasche Champagner mit einer Nachricht vom Arzt meiner Frau: «Ich habe es Ihnen gesagt.»
War der Nobelpreis schon immer Ihr Ziel?
Nein. sicher nicht. Jedes Jahr hat es mehrere 100 Forschende, die für den Nobelpreis der Physik in Frage kommen. Ich kenne ihre Arbeiten nicht. Aber sie haben sicher alle aussergewöhnliche Arbeit geleistet. Zu erwarten, dass man den Preis bekommt, wäre falsch. Es gibt Leistungen wie die Entdeckung des Boson-Higgs, bei diesen ist sofort klar, dafür gibt es den Nobelpreis. Aber oft ist die Situation nicht so eindeutig.

Soll sich ein junger Forscher den Nobelpreis als Ziel setzen?
Wer als Ziel seiner Forschung den Nobelpreis hat, soll sofort aufhören zu forschen. Der Antrieb zur Forschung muss die Neugierde sein. Es muss die Freude sein, wie etwas kleines neues im Universum zu finden, das dazu beiträgt, das Verständnis vom Universum zu verbessern.
Der Preis hat die Menschen bewegt?
Damit das klar ist, ich bin glücklich, dass ich ihn erhalten habe. Er hat stimuliert. Heute gibt es viel mehr Forschende auf diesem Gebiet. Unsere Aufgabe ist es, dieses Wissen an die Öffentlichkeit zu tragen. Es wird gemacht, aber es hat noch Potenzial. Wenn wir an das goldene Zeitalter der Astronomie denken haben wir Newton, Keppler oder Kopernikus im Kopf. Mit der Relativitätstheorie, der Entdeckung der Expansion des Universums, des Ursprungs des Sonnenlichts und der chemischen Elemente sowie anschliessend derjenigen der Exoplaneten bot auch das 20. Jahrhundert eine Bühne für grosse Entdeckungen.
War für Sie immer schon klar, dass Sie Forscher werden wollen?
Wissenschaft hat mich schon als Kind enorm interessiert, die Geologie der Alpen, die Botanik oder auch die Meteorologie. Nach der Matura wurde ich mehr ein Theoretiker. Ich begann ein Physik- und ein Mathematikstudium. Schliesslich entschied ich mich für die theoretische Physik. Mein Diplom machte ich in einer Zeit, als alle Labors am Ausbauen waren. Und so hatte ich keine Probleme, eine Stelle zu finden. Ich landete am Observatorium der Universität Genf.
Sie blieben der Universität Genf treu.
Nach meiner Doktorarbeit hatte ich bereits ein Stipendium für das MIT in Boston. Dann lernte ich einen Forscher in England kennen. Dieser arbeitete an einer neuen Methode zur Bemessung der Geschwindigkeit von Sternen. Doch er hatte kaum Mittel. Diese Begegnung hat mich dazu gebracht, in die Geräteentwicklung zu wechseln.
Welche Bedeutung hat die Geräteentwicklung?
Ein Beispiel: Vor zwanzig Jahren erhielten wir den Zuschlag, mit HARPS einen neuen Spektrographen für das Teleskop in Chile zu konstruieren. Wir mussten es bezahlen, die Fachkräfte für den Bau organisieren. Aber nach fünf Jahren Bauzeit erhielten wir dafür das Recht, das grosse Teleskop 500 Nächte zu nutzen. Das ist der Jackpot. Normalerweise kämpft man, dass man es für drei oder vier Nächte nutzen darf. Für ein astronomisches Institut wie die Sternwarte Genf ist es von entscheidender Bedeutung, neue Forschungsinstrumente entwickeln zu können. Die Entdeckung von 51 Pegasi b ist ein schönes Beispiel.
Was geschah mit Ihrem MIT-Stipendium?
Ich bin nach Genf zurückgekommen und habe dem Direktor unseres Instituts mitgeteilt, was ich machen möchte. Er begann zu lachen: Ich als Theoretiker wollte mit astronomischer Instrumentierung arbeiten. Ich fragte, ob ich das Geld für das Stipendium für die Entwicklung des Gerätes nutzen konnte. Auch erhielt ich Geld vom Schweizerischen Nationalfonds. 150’000 Franken. Das war nicht viel, aber es war, was ich brauchte. Wir entwickelten ein wunderbares Gerät. Es bot so viele Möglichkeiten. Es hätte mich frustriert, dieses zu verlassen.
Und so blieben Sie in Genf?
Ich machte ein paar Auslandsaufenthalte, etwa im Observatorium in Chile. Aber ich blieb an der Universität Genf. Ich war glücklich mit den Möglichkeiten vor Ort. Weshalb sollte ich Genf verlassen? Hier habe ich 1971 promoviert. Es war der Beginn dieses ausserordentlichen Abenteuers.