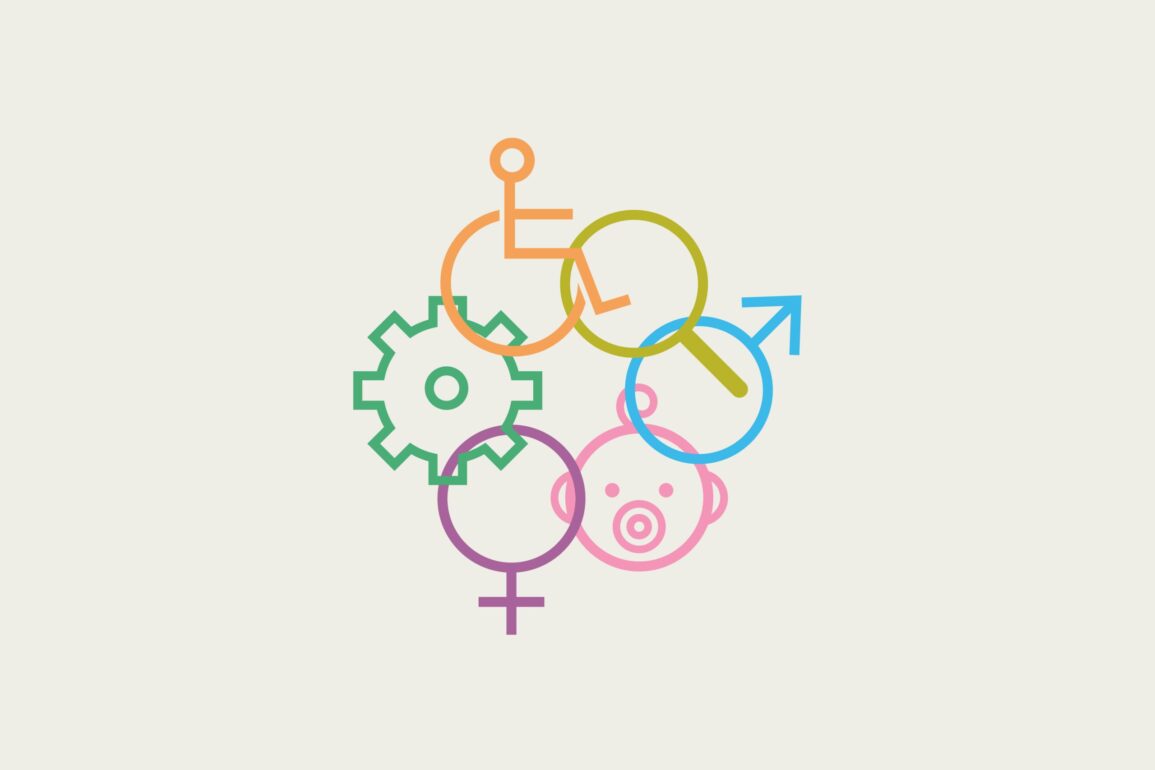An der Fernfachhochschule Schweiz (FFHS) wird geforscht – auch stiftungsfinanziert – und gelehrt. Eine aktuelle Studie über Einrichtungen für erwachsene Menschen mit Behinderung zeigt exemplarisch, wie anwendungsorientierte Grundlagenforschung an der FFHS funktioniert.
«Die Idee, dass Grundlagenforschung im Sozialbereich vermarktbar ist, stösst immer wieder klar an Grenzen», gibt Daniel Zöbeli, Leiter devs Instituts für Management und Innovation, zu bedenken. Es mache nicht bei jeder Forschung Sinn, auf einen Business Case hinzuarbeiten, wie es etwa von der staatlichen Förderagentur Innosuisse verlangt werde.

«Die FFHS forscht genau deshalb auch stiftungsfinanziert», wirft Daniela Mühlenberg-Schmitz, Forschungsfeldleiterin und Dozentin an der FFHS, ein. Sie leitet aktuell eine Studie, bei der es um die Erfassung und Finanzierung von Betreuungsleistungen in Einrichtungen für erwachsene Menschen mit einer Behinderung in der Schweiz (Erfibel) geht.

Die Hochschule für soziale Arbeit in Olten und das Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale (DEASS) aus dem Tessin decken den sozialpädagogischen Aspekt, die FFHS den betriebswirtschaftlichen ab. Hintergrund der Studie ist der Wechsel der Finanzhoheit über die Behinderteneinrichtungen vom Bund zu den Kantonen. Es geht
u. a. darum, Fehlanreize der gängigen Finanzierungsmodelle aufzuzeigen und Lösungen vorzuschlagen, wie die Betreuungsqualität trotz knapper werdenden Staatsfinanzen nach wie vor sichergestellt werden kann.
Wenn an der Finanzierungsschraube gedreht wird
Das Projekt Erfibel hat einen sozialen Hintergrund. «Es geht nicht um einen knallharten Business Case», betont Daniela Mühlenberg-Schmitz, es gehe vielmehr darum, zu erfahren, was es letztlich für Menschen mit einer Beeinträchtigung bedeutet, wenn an der Finanzierungsschraube gedreht werde. «Es zeichnet sich ein Klärungsbedarf zwischen den Kantonen und Institutionen ab», betont die Forscherin. «Die Kantone wechseln von einer Defizitgarantie zu Pauschalbudgets. Sie setzen für die Finanzierung auf den sogenannten Individuellen Betreuungsbedarf (IBB), bei welchem ein Leistungsraster zum Einsatz kommt», erklärt sie. Die Analyse zeige nun, die Kantone schätzen die Entscheidungsautonomie der Institutionen deutlich höher ein als diese selber. Sie seien ausserdem recht zufrieden mit der Umsetzung und der Einführung des IBB. Einzelne Institutionen erachten dagegen das Raster als wenig passgenau. Sie sehen grundlegende Rechte der Behinderten verletzt; bspw. die freie Wahl der Institution, etwa wenn betreuungsintensive Klienten mangels ausreichender Finanzierung keinen geeigneten Heimplatz mehr erhalten. Die Studie scheint auf grosses Interesse zu stossen. «Es haben sich alle Kantone und 40 Prozent der Institutionen beteiligt», freut sich Daniela Mühlenberg-Schmitz, und ergänzt, «es geht um viel Geld, drei bis vier Prozent der Kantonsbudgets, und es gibt rund 600 dieser Institutionen. Das ist auch für die Öffentlichkeit interessant.»
Nicht über, sondern mit den Menschen
«Heute wird viel über Menschen mit Beeinträchtigung geforscht und nicht mit ihnen», gibt Daniela Mühlenberg-Schmitz zu bedenken, «das wollen wir anders machen.» Beantwortet werden sollen die detaillierten Anschlussfragen des zweiten Teils der Studie von Personen mit Beeinträchtigung. «Die Institutionen berichten uns über einen gewissen Leistungsabbau», erklärt die Forscherin, «nun wollen wir verstehen und verifizieren, wo und wie die Behinderten den Leistungsabbau wahrnehmen.» Auch die zweite Phase der Studie ist stiftungsfinanziert. «Dieses Projekt hat uns gezeigt, wie wichtig Fundraising-Know-how ist, dass man weiss, wie man ein Gesuch schreibt», wirft Daniel Zöbeli ein. «Stiftungsfinanzierung ist zeitaufwändig und anspruchsvoll. Wir haben für die zweite Phase noch nicht den gesamten Betrag beisammen.» Das Learning sei, man müsse mit den unterschiedlichen Stiftungen ein Vertrauensverhältnis aufbauen und ihnen aufzeigen, welchen gesellschaftlichen Nutzen solche Forschungsprojekte haben. Oft brauche es jemanden, der einem die Türe öffne. Nach Abschluss der zweiten Phase sollen für die Behinderteneinrichtungen nachhaltigere Modelle erarbeitet werden. «Wir möchten gerne von der Analyse zur Empfehlung kommen und gewisse Prototypen erarbeiten», betont Daniela Mühlenberg-Schmitz, «dazu müssen wir erneut auf Geldsuche gehen.» Ziel ist es, den Institutionen Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, dass diese sowohl den finanziellen Rahmenbedingungen als auch gleichzeitig den eigenen Betreuungskonzepten gerecht werden. «Das ist kein Widerspruch – wir sehen hier bereits einzelne gute Beispiele in der Praxis.»
Distance Learning
«80 Prozent des Lernens findet an der FFHS über Internet mittels Blended Learning statt – und das schon seit 20 Jahren», erklärt Daniel Zöbeli. Aktuell studieren an allen Standorten rund 2500 Personen. Die FFHS beschäftigt 140 Angestellte und 400 Dozierende. Sie wurde 1998 gegründet, um jenen Leuten, damals u. a. mit dem Gedanken, die in etwas abgelegen Tälern wohnen, eine Aus- und Weiterbildung zu ermöglichen. Getragen wird die FFHS heute von der gemeinnützigen Stiftung Fernfachhochschule Schweiz. Ein Forschungsschwerpunkt befasst sich mit Nonprofit-Organisationen, wobei Finanzierungs‑, Governance- und Transparenzfragen im Zentrum stehen. Etliche Studien, etwa über Stiftungsratshonorare oder externe NPO-Mandate wurden gemeinsam mit dem Center for Philanthropy Studies (ceps – Basel) veröffentlicht.