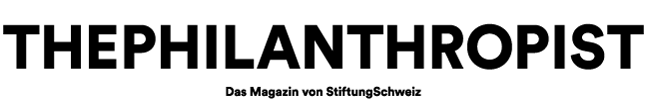Sie forschen zur Transformation zu einem nachhaltigen Ernährungssystem. Wie relevant ist das Thema für eine demokratische Gesellschaft?
Es ist sehr relevant. Aktuell führen wir beispielsweise eine computerlinguistische Analyse der öffentlichen Diskurse zum Thema Ernährung in verschiedenen Ländern weltweit durch, etwa in den EU-Staaten, Indien, Nigeria, Südafrika, den USA und der Schweiz. Wir untersuchen dafür Millionen von Medienberichten. Essen ist ein zentrales Kulturelement. Es ist nicht nur mit emotionalen und biologischen Prozessen verbunden, sondern hat auch eine zentrale gesellschaftspolitische Dimension und insbesondere das Thema Fleisch birgt Polarisierungspotenzial.
Was bedeutet dies?
Essen wird zunehmend zu einem Bestimmungsmerkmal in einer Gesellschaft. Bestimmte Personengruppen werden darüber definiert. Es gibt die Stereotypen der urbanen Veganer:innen oder die Trump-Wähler mit ihrem Burger und Steak.
Was ist die Folge für die Gesellschaft?
Es werden Zuschreibungen gemacht, die Gruppenidentitäten verstärken. Das erschwert das gegenseitige Zuhören. Gleichzeitig kann Essen aber genau das Gegenteil bewirken.
Inwiefern?
Essen kann die Menschen zusammen an einen Tisch bringen. Sie begegnen sich. Es gibt tolle Projekte. Diese sollen Menschen verschiedener Kulturkreise oder mit unterschiedlichen politischen Einstellungen beim Kochen an einen Tisch bringen – im wörtlichen Sinn. Das ist eine grosse Chance. Besonders wichtig scheint mir aber, dass wir auf politischer Ebene agieren, dass wir die Ernährungssystem-Gouvernanz – also die Institutionen und Art der gesellschaftspolitischen Zusammenarbeit – anpassen. Wir haben im Bericht «Wege in die Ernährungszukunft der Schweiz» die Schaffung eines Zukunftsgremiums angeregt. In diesem sollten die wichtigsten gesellschaftlichen Akteure und Interessengruppierungen, welche privatwirtschaftliche und öffentliche Güterinteressen im Ernährungssystem vertreten, vertrauensbildend zusammenarbeiten und Lösungen miteinander verhandeln.
«Die Transformation des Ernährungssystems ist zentral für den Zusammenhalt der Gesellschaft.»
Lukas Fesenfeld, Politik-Wissenschaftler
Wer könnte ein solches Gremium einberufen?
Idealerweise wird es durch das Parlament bzw. den Bundesrat legitimiert und sollte nicht an einzelnen Bundesämtern hängen. Es braucht eine umfassende Zusammensetzung von Akteuren, die im Gremium möglichst das gesamte Ernährungssystem repräsentieren – also neben den Produzierenden und Bäuerinnen und Bauern auch die verarbeitende Wirtschaft, den Handel, die Konsument:innen sowie NGOs, die Arbeitnehmer‑, Gesundheits‑, Tierwohl- und Umweltschutz vertreten.
Wie bestimmt man die Akteur:innen?
Sie müssten auf Basis transparenter Kriterien, einer systematischen Stakeholder-Analyse sowie in einem wissenschaftlich begleiteten Prozess gewählt werden. Das Zukunftsgremium sollte vorgelagert und begleitend zum parlamentarischen Prozess arbeiten. Die Ergebnisse aus diesen Diskussionen können dann in den gesetzgebenden Prozess einfliessen und idealerweise tragfähigere und langfristigere Lösungen ermöglichen. So könnte es auseinanderdriftenden Effekten entgegenwirken.
Wie lässt sich dies erreichen?
Es ist wichtig, den Fokus auf die Chancen und das Miteinander zu richten. Lange sind wir im globalen Ernährungssystem – auch in der Schweiz – einer politikökonomischen Logik gefolgt, die entlang der Wertschöpfungskette die Konzentration hin zu grösseren Betrieben förderte. Beziehen die Supermarktketten von grösseren Produzierenden Waren, profitieren sie von Skaleneffekten, was wiederum günstigere Preise ermöglicht. Die Konsument:innen haben sich an dieses Preisniveau gewöhnt. Auch die Subventionen in vielen Ländern wurden auf grössere Betriebe anstatt auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Ein Fehlanreiz. Das hat viele kleinere Höfe zum Aufgeben gezwungen und zu grossem Frustrationspotenzial in der Landwirtschaft geführt, gerade weil viele im Sektor ihre Arbeit als Lebensaufgabe sehen. Dieser Umstand kann, wie wir es in anderen Ländern beobachten, von demokratiefeindlichen Kräften genutzt werden. Deswegen ist die Transformation des Ernährungssystems so zentral für den Zusammenhalt der Gesellschaft.
Wie kann die Schweiz bei einem Selbstversorgungsgrad von rund 50 Prozent überhaupt Einfluss nehmen?
Die Schweiz kann einen wichtigen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit leisten, durch die Art der Produktion und den Konsum im Inland, aber auch die Regulierungen beim Import und Export von Lebensmitteln. Derzeit fallen beispielweise rund 77 Prozent Treibhausgasemissionen der in der Schweiz konsumierten Lebensmittel im Ausland an. Der Selbstversorgungsgrad ist jedoch nicht der einzige Indikator für die Umstellung hin zu einem nachhaltigen Ernährungssystem. Wirtschafts‑, Umwelt- und Gesundheitsziele lassen sich jedoch mit einer Erhöhung des Selbstversorgungsgrades in der Schweiz gut kombinieren. Ernährungssicherheit und Nachhaltigkeit bedingen sich gegenseitig.
Wie könnte dies gelingen?
Mit einer Umstellung des Konsumverhaltens. Dies hätte Auswirkungen auf Produktion und Verarbeitung sowie den Import. Derzeit werden auf mehr als 40 Prozent der Ackerflächen in der Schweiz Futtermittel angebaut. Aufgrund von Futtermittelimporten kommen noch mindestens 200’000 Hektaren Ackerfutterflächen im Ausland hinzu. Das ist ineffizient und gefährdet die Ernährungssicherheit. Auf diesen Ackerflächen im In- und Ausland könnten deutlich mehr pflanzliche Lebensmittel für den menschlichen Konsum produziert werden. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig zu betonen, dass die Schweiz einen Standortvorteil bei graslandbasierter Tierhaltung hat, gerade in der Alpenregion.

«Die Schweiz kann deutlich schneller davon betroffen sein, als wir es bislang erwartet haben.»
Lukas Fesenfeld
Die dann doch Sinn machen würde?
Aus einer globalen Nachhaltigkeits-perspektive würde es Sinn machen, wenn die Schweiz gewisse Gemüse- und Obstsorten importiert, bei welchen sie keinen Standortvorteil hat. Dafür kann sie tierische Produkte exportieren, wenn diese auf bestehenden Grasflächen und nicht mit importiertem Futtermittel hergestellt werden. Insgesamt müsste dafür aber der inländische Konsum tierischer Produkte sinken und die Schweizer Verbraucher:innen sollten weniger, aber vor allem Schweizer Produkte aus der graslandbasierten Tierhaltung konsumieren. Das hiesse nicht nur weniger Konsum tierischer Produkte insgesamt, sondern insbesondere weniger Konsum von Geflügel- und Schweineprodukten, die besonders stark auf den Import von Futtermitteln angewiesen sind.
Aus globaler Sicht ist es also nicht per se nachhaltiger, weniger zu importieren. Entscheidend ist, das Richtige zu importieren?
Genau. Das Idealszenario wäre, dass alle Länder und Regionen weltweit die Produkte produzieren, bei welchen sie aus sozialer, ökologischer und zum Teil auch ökonomischer Perspektive einen Standortvorteil haben. Nur ist das nicht die Realität.
Wie lässt sich graslandbasierte Produktion fördern?
Wir müssen einerseits den Futtermittelimport teurer gestalten. Gleichzeitig müssen wir Anreize schaffen für die Wertschöpfung in alternativen Bereichen, beispielsweise beim Anbau von Hülsenfrüchten. Oder wir ermöglichen Landwirtschaftsbetrieben neue Einkommensquellen, wie mit dem Ausbau der Agrophotovoltaik. Am Ende ist aber auch die Akzeptanz der Konsument:innen entscheidend.
Wovon hängt diese ab?
Unsere repräsentativen Experimente mit der Bevölkerung zeigen, dass bei der richtigen Kombination von Massnahmen die Akzeptanz zum Konsumwandel bereits heute höher ist als oftmals angenommen. Hier sind neben dem Staat vor allem der Detailhandel und die Kantinen gefragt. Die Vermarktung spielt eine grosse Rolle. Und schliesslich ist die Subventions- und Steuerpolitik entscheidend. Heute wird die Tierhaltung – auch die nicht graslandbasierte – stark gefördert. Das setzt entsprechende Anreize und fördert leider nicht gezielt den nachhaltigen Konsum. Besonders die Bäuer:innen sollten beim Transformationsprozess nicht allein gelassen werden, sondern vom Umstieg hin zu mehr Pflanzenbau und graslandbasierter Tierhaltung profitieren.
Reicht dies, um das Ernährungssystem zu transformieren und die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen?
Wenn wir die UN-Nachhaltigkeitsziele, zu welchen sich die Schweiz verpflichtet hat, ernst nehmen und die Schweiz einen fairen Beitrag zu deren Erreichung bis 2030 leisten will, dann müssten wir deutlich schneller umstellen. Politökonomisch ist das aber leider derzeit nicht besonders realistisch.
Was wäre ein gangbarer Weg?
Es braucht ein Miteinander statt ein Gegeneinander. Ein möglicher Weg ist eine sinnvolle Abfolge der Massnahmen. Wir müssen zunächst den Fokus auf die Chancen legen und neue Wertschöpfungsmöglichkeiten in den Vordergrund stellen. Der neue dänische Fonds zum Ausbau pflanzenbasierter Wertschöpfungsketten ist hier ein gutes Vorbild. Danach können schrittweise stärkere Anpassungen in der Regulation und Besteuerung folgen.
Könnten Stiftungen hier eine Rolle übernehmen?
Gerade beim Anstossen kann der gemeinnützige Sektor helfen. Am Anfang braucht es viele Aktivitäten, auch in Nischen. Oder beim Anstossen eines Zukunftsgremiums können Stiftungen eine Verantwortung übernehmen. Ebenso bei stärker integrierten Pilotprojekten entlang der Wertschöpfungskette wäre ihre Förderung sinnvoll. Wir sehen oft Projekte, die nur einen Teilbereich abdecken, aber nicht überlegen, wie die gesamte Wertschöpfungskette aussehen muss, damit eine Transformation gelingen kann. Das gilt auch für die Arbeit der Stiftungen.
Das heisst?
Stiftungen können mehr bewirken, wenn sie zusammenarbeiten. Das fängt zum Glück gerade an, dass sie sich überlegen, wo sie komplementär sind, wo sie sich ergänzen können und wo sie zusammen mehr bewirken.
Und mit Pilotprojekten Entwicklungen anstossen?
Gut umgesetzte Pilotprojekte können zeigen, dass etwas funktioniert. Dies trägt dazu bei, dass Produzierende umstellen, Abnehmer:innen finden und die Politik die Handhabung der Förderung anpasst. Wenn wir dann eine Skalierung erreichen wollen, übersteigen die benötigten Summen jedoch die Möglichkeiten des gemeinnützigen Sektors. Deswegen ist es sinnvoll, auch hier strategisch und schrittweise vorzugehen und mit verschiedenen Formen eines Fonds den Anschub zu finanzieren. Schlussendlich wäre die Idealvorstellung ein gross angelegter Transformationsfonds, wie wir ihn im Rahmen des Berichtes «Wege in die Ernährungszukunft der Schweiz» skizziert haben. Dieser Fonds könnte Kosten für gezielte Beratung im Umstellungsprozess, Förderung von Forschung und Entwicklung sowie infrastrukturelle Ausgaben bei der Umstellung entlang der Wertschöpfungskette übernehmen. Gleichzeitig sollte er auch finanzielle Kompensation für die Verlierer:innen leisten.
Wen erwarten Sie als Verlierer:in?
Ich denke an Bauernhöfe, die vor kurzem in neue Ställe investiert haben, weil sie durch die aktuelle Subventionspolitik dazu angeregt wurden. Dabei gilt es genau zu differenzieren zwischen der unternehmerischen Selbstverantwortung und der Anregung durch die gesellschaftliche Subventionspolitik. Es muss geklärt werden, wann die Entscheide zur Investition gefällt wurden, um gerechtfertigte Kompensationen zu leisten für Höfe, die Kapital durch den Transformationsprozess verlieren.
«Wir müssen den Fokus auf die Chancen legen.»
Lukas Fesenfeld
Bereits heute fliessen viele Gelder in die Landwirtschaft.
Genau, gerade auch öffentliche. Diese müssten teils umgelenkt werden. Langfristig braucht es zudem gar nicht mehr unbedingt so viel neues Geld. Schätzungen gehen von jährlich rund 35 Milliarden Franken externen Kosten durch den derzeitigen Schweizer Lebensmittelkonsum aus, die heute in anderen Bereichen wie der Gesundheitsversorgung oder durch Umweltschäden anfallen. Würden diese wahren Kosten eingerechnet, würde die Gesellschaft insgesamt von einer Transformation zu einem nachhaltigen Ernährungssystem profitieren.
Ein nachhaltiges Ernährungssystem wäre also auch besser für die Gesundheit?
Ja, natürlich. Es kommt auf die Definition der Nachhaltigkeit an. Normalerweise gehört dazu die ausgewogene, gesunde Ernährung. Es gibt den Ansatz der Planetary Health Diet. Dieses Konzept definiert einen Speiseplan, der die Gesundheit des Menschen wie des Planeten berücksichtigt.
Wie erreichen wir diese Transformation?
Einerseits erkennen die Akteure heute, dass die Chancen grösser sind als bisher angenommen. Andererseits entstehen neue Interessengruppen, ähnlich wie beim Ausbau der erneuerbaren Energien, die sich für fundamentale Reformen einsetzen werden. Dazu gehören Änderungen in der Subventionspolitik oder bei den Zöllen. Aktuell ist das im Bereich der Ernährungs- und Landwirtschaftspolitik noch nicht realistisch, weil zu viele Akteure derzeit noch vom Status quo profitieren oder zumindest davon zu profitieren meinen. Ein Interesse für Veränderung gibt es erst, wenn wir glaubwürdig zeigen, dass ein Wandel grosse Chancen bringt. Dazu braucht es konkrete Massnahmen. Das dürfen nicht nur neue Auflagen sein, sondern die neuen Massnahmen müssen auch mit administrativen Vereinfachungen für die Bauernbetriebe einhergehen.
Können Sie ein Beispiel nennen?
Werden auf regionaler Ebene Mindestindikatoren für den Umweltschutz festgelegt, können diese satellitengestützt überprüft werden und die Auszahlungen öffentlicher Subventionen auf diesen Daten erfolgen. Der administrative Aufwand wird geringer. Gerade kleine Betriebe profitieren. Auf Konsument:innenseite wären nicht nur Veränderungen im Kantinenangebot, sondern auch die Einführung einer Tierwohlabgabe denkbar, wie sie derzeit in Deutschland diskutiert wird. Das würde nicht nur den Konsum verändern, sondern auch neue Mittel für die Transformation generieren. Diese Finanzierung ist wichtig für Bäuer:innen, welche die Umstellung bewerkstelligen. Sie brauchen Planungs- und Finanzierungssicherheit.
Sind eine Transformation der Ernährungssicherheit und Nachhaltigkeit Gegensätze?
Global verursacht das heutige Ernährungssystem rund 30 Prozent der Treibhausgasemissionen, einen Grossteil des Artenverlustes und rund 70 Prozent des Frischwasserverbrauchs. Laut des globalen Berichts der FoodSystem-Economics-Experten-Kommission, an dem ich mitwirken durfte, belaufen sich die jährlichen Kosten des derzeitigen Ernährungssystems für Mensch und Natur auf über zehn Billionen Dollar pro Jahr. Das sogenannte Wedding-Cake-Modell der Nachhaltigkeit besagt, dass alle sozialen und ökologischen Ziele auf einem intakten Ökosystem beruhen. Fehlt dieses, kann nicht tragfähig gewirtschaftet werden, es entstehen Hunger, Konflikte, Pandemien, und politische Unruhen. Dies wirkt sich schnell auf die globale Wertschöpfung aus. Auch die Schweiz kann deutlich schneller davon betroffen sein, als wir es bislang erwartet haben.