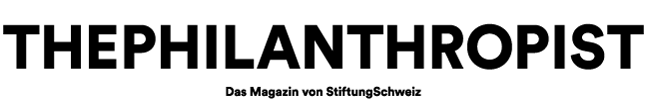Ein Flugzeugabsturz, ein Tunnelbrand, ein Amoklauf: Kaum vorstellbar, was ein solches Ereignis und das damit Erlebte mit einem machen. Sie geschehen. Unverhofft und plötzlich. Sie fordern die betroffenen Menschen und überfordern sie. Für Verantwortliche in involvierten Unternehmen eine riesige Herausforderung. Sie müssen im Krisenmoment einer Vielzahl Mitarbeitenden Unterstützung anbieten und sie müssen selbst mit der Situation umgehen.
Die Stiftung Carelink ist auf die Bewältigung solcher Ereignisse spezialisiert. Grossereignisse gehören zu ihren Aufgaben. «Die häufigsten Einsätze gelten jedoch Situationen, die eine kleinere Gruppe von Menschen betreffen, beispielsweise Suizide in Unternehmen, Unfälle oder Überfälle, Bedrohungen, Gewaltanwendungen», sagt Geschäftsführerin Carolin Wälz. «Solche Geschehnisse erschüttern die Menschen in der unmittelbaren Umgebung.»

Extremsituationen
Was in diesen speziellen Situationen geschieht und wie ein Mensch reagiert, ist schwer vorherzusehen. «Unter extremem Stress reagieren Menschen häufig ganz anders, als sie dies von sich selbst kennen», sagt Carolin Wälz. Hilflosigkeit, Ohnmacht, aber auch Wut und Trauer – die Reaktionen können sehr unterschiedlich ausfallen. Carelink bietet Entlastung. Sie unterstützt die Betroffenen dabei, wieder Struktur, Sicherheit und Ruhe zu finden. Ziel ist es, das Erlebte zu verstehen und einzuordnen. «Wenn die Betroffenen dies artikulieren können, wird eine innere Ordnung hergestellt», sagt sie. Weil Carelink auf diese Ereignisse spezialisiert ist, kann sie mit ihrer Erfahrung den Unternehmen und den betroffenen Menschen in der Krisensituation zeigen, wie diese durchgestanden werden kann. Diese Führung hätte auch in der Extremsituation Pandemie in den vergangenen Jahren für die Gesellschaft als Ganzes hilfreich sein können. In dieser Zeit wurde lange die psychische Belastung für breite Teile der Bevölkerung vernachlässigt.
«Die Pandemie war eine Extremsituation für die Gesellschaft und stellte für viele Menschen eine Herausforderung für die psychische Gesundheit dar», sagt Stéphanie Mertenat Eicher, Geschäftsleiterin der Fondation O2. Die in der Westschweiz angesiedelte Stiftung ist ein Kompetenzzentrum für Entwicklung und Prävention, Gesundheitsförderung und nachhaltiges Entwicklungsprojektmanagement, das sich insbesondere mit der psychischen Gesundheit befasst.

Sie fügt an: «Diese Zeit war für alle äusserst kompliziert, vor allem aber bei Menschen, die bereits geschwächt sind, hat die psychische Gesundheit stärker gelitten.» Während sich ein Unternehmen auf Krisensituationen vorbereiten und die Resilienz stärken kann, indem es Notfallpläne ausarbeitet und ein Betreuungsangebot einplant, muss auch eine Gesellschaft aus den erlebten Ereignissen die Lehren ziehen. Denn die Pandemie hat bestehende gesundheitliche und soziale Ungleichheit verstärkt. «Laut Statistiken des Gesundheitsobservatoriums (OBSAN) waren Jugendliche, die sich bereits in einer Übergangsphase befanden, die komplex sein konnte, von der Pandemie stark betroffen und müssen sich heute neu aufbauen und vor allem einen Sinn finden», sagt Stéphanie Mertenat Eicher.

«Der Schrei» von Edvard Munch. Der Expressionist drückte in seiner Kunst viel von seiner eigenen inneren Zerrissenheit aus.
Viele Betroffene
«Nach Angaben derselben Beobachtungsstelle leidet jeder zweite Mensch mindestens einmal in seinem Leben an psychischen Problemen (einmalig oder langfristig) und rund 18 Prozent der Bevölkerung leiden an einer oder mehreren psychischen Störungen», sagt Stéphanie Mertenat Eicher. «Grund genug, darüber zu sprechen, weil es uns alle angeht, und zu handeln, um diesen Problemen und Sorgen vorzubeugen.» Auch die Schweizerische Gesundheitsbefragung 2022 zeigt die Belastung der jungen Menschen, insbesondere der Frauen. Bei den 15- bis 24-Jährigen sind 22 Prozent psychisch mittel oder stark belastet. Bei den jungen Frauen sind es 29 Prozent. 18 Prozent der Frauen in diesem Alter litten im vergangenen Jahr unter Angstzuständen.
Sprache als Heilmittel
«Wage es, darüber zu reden» ist ein Slogan, der dazu ermutigt, sich frei zu äussern. Er kommt häufig in Kampagnen zur Förderung der psychischen Gesundheit vor. Stéphanie Mertenat Eicher sieht derzeit eine positive Entwicklung bei jungen Menschen, die Hilfsangebote wie ciao.ch nutzen. Doch bis das Tabu im Bereich der psychischen Gesundheit fällt, sei es noch ein weiter Weg. Die Akzeptanz von Problemen stärkt ihrer Meinung nach die Widerstandsfähigkeit einer Gesellschaft. Es ist jedoch wichtig, das Bewusstsein für psychische Gesundheitsprobleme weiter zu schärfen und die Stigmatisierung zu bekämpfen. Tatsächlich trägt das offene Sprechen über psychische Gesundheit durch den Austausch persönlicher Erfahrungen und die Sensibilisierung dazu bei, Stigmatisierung abzubauen und ein gesundheitsfreundlicheres Umfeld zu schaffen.
Auf die Bedeutung einer öffentlichen Diskussion des Themas weist auch Muriel Langenberger, Geschäftsführerin von Pro Mente Sana, hin. Der Mensch sei als soziales Wesen auf regelmässige Begegnungen angewiesen. «Während der Pandemie waren Begegnungen lange Zeit eingeschränkt, was für viele eine grosse Herausforderung darstellte.» Unsicherheit und Fremdbestimmung hätten die psychische Gesundheit erheblich belastet.

Eigene Resilienz fördern
Die Pandemiesituation hat Probleme offenbart, die unabhängig davon bestehen. Denn die psychische Gesundheit ist auch von Selbstwirksamkeit und Kontrollüberzeugung abhängig. Die eigene Resilienz hängt damit zum einen von der eigenen Fähigkeit und dem Vertrauen, eine schwierige Situation zu meistern, ab. Zum anderen ist es auch das Wissen, in Krisensituationen ein soziales Netz aus Freunden und Familien zu haben, die einen auffangen. Nicht alle verfügen über ein solches Netz. Und die Pandemie hat diese Situation verschärft. «Deshalb ist es wichtig, dass Menschen in der Krise zusätzliche Unterstützung erhalten, zum Beispiel in Form von Beratung und Begleitung», sagt Muriel Langenberger. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, aktiv etwas für das eigene Wohlbefinden zu tun und damit die eigene Resilienz zu fördern. «Regelmässige Bewegung, ausgewogene Ernährung, das Entdecken von Neuem und ausreichend Schlaf tragen dazu bei, genauso wie das Pflegen sozialer Kontakte», führt sie aus. Die eigene psychische Gesundheit zu stärken, hilft, belastende Lebensumstände besser zu bewältigen. Nichtsdestotrotz kann es sein, dass die Balance zwischen Ressourcen und Belastung aus dem Gleichgewicht gerät: Eine psychische Erkrankung kann jede und jeden treffen.
Gemeinsame Bewältigung
Die Geschäftsleiterin der Fondation O2, Stéphanie Mertenat Eicher, weist auf einen weiteren Punkt hin: Unsere mentale Gesundheit entwickelt sich ständig weiter. «Wir können von einem Kontinuum sprechen, da der Mensch je nach gesellschaftlichem Kontext und entsprechend seiner persönlichen Veranlagung unterschiedliche Zustände erlebt. Jeder kann sich neue Fähigkeiten aneignen, um schwierige Phasen zu bewältigen.
Das muss aber erlernt werden. Man muss gut unterstützt und beraten werden, um die richtigen Schlüssel zu finden.»
Das gilt auch für die Mitarbeitenden in Unternehmen. Sie können gemäss Carolin Wälz dazu beitragen, die Resilienz der Unternehmen zu stärken, indem es gelingt, Empowerment, Diversity oder Kollaboration zu etablieren. «Zentral ist, dass es Unternehmen gelingt, die Ressourcen bei ihren Mitarbeitenden zu aktivieren, welche als entlastendes Gegengewicht zur belastenden Ausnahmesituation bei der Ereignisbewältigung unterstützen», sagt sie. Aber jede Situation zeige, dass verschiedene Akteure Verantwortung übernehmen müssen und dass die Bewältigung einer Krise nicht eine Einzelleistung sei, betont sie weiter. Kantonale Careteams oder die Blaulichtorganisationen seien genauso eingebunden. Dieser Ansatz gilt aber nicht nur für die Krise. Auch im Aufbau der Resilienz gilt es, die verschiedenen Aspekte zu berücksichtigen. «Die Stärkung der psychischen Gesundheit ist eine gemeinsame Verantwortung, die sowohl den Einzelnen als auch die Gesellschaft als Ganzes einbezieht. Wir können nicht allein handeln», so Stéphanie Mertenat Eicher. Bereits in der Kindheit können Fähigkeiten erlernt werden, die später helfen, Probleme, bspw. Stress, zu bewältigen.

Edvard Munch mit seinen sehr persönlichen Bildern. Er nannte sie auch seine Kinder.
Sichtbar machen
Auch wenn sich jede und jeder Einzelne um seine eigene psychische Gesundheit kümmern muss, ist Unterstützung von aussen manchmal unerlässlich. Denn psychosoziale Fachkräfte bieten eine objektive und neutrale Sichtweise auf psychische Gesundheitsprobleme, die komplex sein können. «Es ist daher von entscheidender Bedeutung, zu erkennen, dass die Pflege der eigenen psychischen Gesundheit nicht unbedingt bedeutet, dass man sich seinen Problemen allein stellen muss. Personen können Hilfe und Unterstützung von verschiedenen psychosozialen Fachkräften erhalten, um ihr psychisches Wohlbefinden zu verbessern. Die Bevölkerung über die bestehenden Möglichkeiten zu informieren, ist die Aufgabe von Organisationen wie der unsrigen», betont Stéphanie Mertenat Eicher. Dem pflichtet Muriel Langenberger bei. Und sie erkennt, dass die Bereitschaft, über die psychische Gesundheit zu sprechen, gestiegen sei. Seit Corona würden auch die Medien häufiger über das Thema berichten. Doch sie fügt an: «Was nicht bedeutet, dass psychische Erkrankungen kein Tabu mehr sind. Betroffene können nach wie vor Stigmatisierung und Diskriminierung erfahren. Deshalb ist es wichtig, über psychische Gesundheit und die verschiedenen Erkrankungen zu informieren. Je mehr Wissen da ist, desto besser können Vorurteile abgebaut werden.»