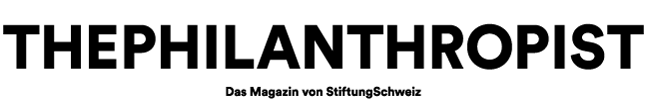Wie eng ist der Pionierfonds in der Corporate-Welt eingebunden und wie stark können die Teams im Bereich Gesellschaft auch selbst neue Zusammenarbeitsformen nutzen?
Als Teil der Direktion Gesellschaft & Kultur des Migros-Genossenschafts-Bundes erfüllt der Pionierfonds zwar einen gesellschaftlichen Auftrag, ist aber dennoch eng in die Migros-Gruppe eingebunden. Das gilt für das ganze gesellschaftliche Engagement der Migros-Gruppe, das einen tragenden Pfeiler unserer Migros-Identität bildet. Zugleich ist transversale Zusammenarbeit in unserem Unternehmen eine gelebte Praxis. Das ist entscheidend, denn Zusammenarbeit über die Silos hinaus braucht Übung und sie gelingt besonders gut, wenn sie auf einem gemeinsamen Verständnis und einer gemeinsamen Arbeitsweise beruht. Im Kontext von New Work kommen nun zahlreiche technische Tools und Prozesse dazu, welche die Migros gruppenweit zur Verfügung stellt, von der kollaborativen Whiteboard-Applikation bis zur hybriden Videokonferenz-Plattform. Wir haben diesbezüglich in jüngster Zeit – bedingt durch die äusseren Umstände – viele Erfahrungen gesammelt: so zum Beispiel auch im Durchführen von interaktiven Online-Workshops, mit unseren Projektpartner*innen. Und wir wissen heute besser, was funktioniert und was nicht. Nicht jede Situation lässt sich eins zu eins in den digitalen Kontext übertragen.
Sie arbeiten oft mit dem Stiftungssektor zusammen – die Migros ist assoziierte Partnerin von SwissFoundations – wie hat sich diese Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren entwickelt?
Durch unseren Auftrag haben wir traditionellerweise eine enge Zusammenarbeit mit anderen zivilgesellschaftlichen Akteur*innen. Viele unserer Projekte im Bereich Gesellschaft werden kooperativ und nach dem Subsidiaritätsprinzip entwickelt und finanziert (vgl. Kommentar von Cornelia Hürzeler). Unsere nationalen sozialen Projekte sind ausnahmslos Kooperationsprojekte mit mindestens einem weiteren Partner aus dem Stiftungssektor oder der Fachhochschullandschaft. Auch der Migros-Pionierfonds operiert in enger Abstimmung mit dem Stiftungssektor.
Abstimmung und Kompatibilität sind von zentraler Bedeutung.
Stefan Schöbi
Schon mehrmals haben wir Projekte von anderen Finanzierern übernommen und schweizweit skaliert, so zum Beispiel den Materialmarkt OFFCUT (Christoph Merian Stiftung u.a.) oder die Startup Academy (Gebert Rüf Stiftung u.a.). So bringen die Partner nicht gleichzeitig, sondern nacheinander ihre Stärken ein. Aber auch das gemeinsame Kräftebündeln kommt immer häufiger vor: Mit der Stiftung Mercator Schweiz verbinden uns im Moment gleich mehrere Projekte, bei denen wir gemeinsam Neuland betreten. Das zeigt: Abstimmung und Kompatibilität sind von zentraler Bedeutung. Und hier gibt es im Stiftungs- und Fördersektor noch Luft nach oben.
Gibt es bezüglich Zusammenarbeit besonders innovative Projekte?
Das Modell von Co-Impact ist aus meiner Sicht interessant und inspirierend. Verschiedene Stiftungen poolen hier ihre Mittel und öffnen ihr Portfolio gleichzeitig für weitere Co-Investoren. Die Basis hierfür ist ein gemeinsamer thematischer und regionaler Fokus – in diesem Fall Armutsbekämpfung im globalen Süden – und geteilte Grundsätze bei der Umsetzung, eine Art methodischer Werkzeugkasten. Dieses Modell ist transparent dokumentiert, deshalb lassen sich auch einfach einzelne Elemente daraus umsetzen. Die Jacobs Foundation verfolgt mit ihrer Initiative «Friends of Education» einen ähnlichen Portfolio-Ansatz im Bildungsbereich und Clima Now macht gerade dasselbe für Klimaprojekte in der Schweiz.
Welche Chancen siehst du für gemeinnützige Organisationen durch neue Modelle der Zusammenarbeit?
Die genannten Beispiele zeigen: durch eine verstärkte Zusammenarbeit wird Förderung zielgerichteter und effizienter, vor allem aber wirksamer und nachhaltiger. Denn die gemeinsame Bearbeitung eines Themas erlaubt es, über das Einzelprojekt hinaus zu blicken, langfristige Perspektiven einzunehmen und systemische Zusammenhänge wirkungsvoll anzugehen. Die Zusammenarbeit stärkt also in erster Linie die Wirkung. Vor diesem Hintergrund überrascht es deshalb nicht, dass auch die Destinatäre die neue Form der Zusammenarbeit unter Geldgebern einfordern. Eine Learning Journey, die von Ashoka und Collaboratio Helvetica organisiert und gerade abgeschlossen wurde, verdeutlicht eindrücklich die zentrale Bedeutung verstärkter Zusammenarbeit. Die Teilnehmenden, ein halbes Dutzend Förderstiftungen, sind sich darüber einig. Der Hund liegt, wie so oft, im Detail begraben: bei der konkreten Umsetzung der Zusammenarbeit.
Gibt es Grenzen, Mindestanforderungen, Prozesse, welche aus deiner Erfahrung notwendig sind für das Gelingen eines Projektes oder ist für kollaborative Modelle alles möglich?
Die Zusammenarbeit muss vor allem Sinn machen. Nicht jedes Projekt braucht zum Erfolg zwingend ein kollaboratives Modell. Das Bon mot ist schon gültig: Wer schnell sein will, geht am besten allein, wer aber weit kommen will, geht am besten zusammen. Im Fokus für kollaborative Modelle stehen in diesem Sinne Projekte, die ihre Wirkungsweise bereits unter Beweis gestellt haben und nun nachhaltig verankert werden sollen.
Wir können als Geldgeber nur einfordern, was wir auch selber glaubwürdig vorleben.
Stefan Schöbi
Seit Herbst 2021 unterstützen wir zusammen mit fünf anderen Geldgebern beispielsweise ein Stiftungskonsortium für den Thinktank foraus. Damit wollen wir nicht nur die nachhaltige Weitentwicklung von foraus sichern, sondern auch exemplarisch herausfinden, wie wir die Hürden für eine solche Zusammenarbeit senken können. Welche Projekte sich für kollaborative Modelle eignen. Was die Projekte dazu mitbringen müssen, aber auch, was die Förderpartner mitbringen sollten. Denn jede Stiftung hat einen eigenen Zweck, eigene Entscheidungsstrukturen und eine eigene Arbeitsweise. Zusammenarbeit bedeutet jedoch, dass man eigene durch gemeinsame Standards ersetzt, sei es für einen Vertrag oder ein Reporting. Und hier, so stellen wir fest, fehlt bisweilen das Werkzeug. Am Willen liegt es nicht.
Wie wichtig ist es für den Erfolg eines Projektes, dass sie sich das Team auch bei der eigenen Organisation an den aktuellen Ansprüchen und Vorstellungen der Gesellschaft orientiert?
Es ist eine Frage der Glaubwürdigkeit und der Konsequenz. Das gilt übrigens auch umgekehrt: Wir können als Geldgeber nur einfordern, was wir auch selber glaubwürdig vorleben. Was dies für die Zusammenarbeit mit Projektpartner*innen bedeutet, haben wir mit unserem Ende Januar erschienenen Handbuch «Von 0 auf 100» zu zeigen versucht. Es hält nicht nur unsere Ansprüche an Projektpartner*innen fest, sondern dokumentiert gleichzeitig auch unsere eigene Arbeitsweise – weil wir die gleichen Grundsätze, die wir von anderen erwarten, auch auf uns selbst anwenden. Seit wir das konsequent machen, ist die Zusammenarbeit einfacher, fruchtbarer und bereichernder geworden. Der auf diese Weise geteilte Werkzeugkasten macht Spass. Das lässt sich auch auf die Zusammenarbeit unter Stiftungen übertragen: Gemeinsame Haltungen und geteilte Arbeitsweisen machen sie leichter und wirkungsvoller zugleich.