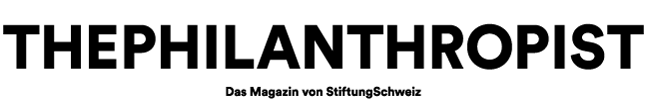Immer grösser, dafür immer weniger: Die Entwicklung bei den Bauernbetrieben in der Schweiz geht genau in eine Richtung und immer weiter. 48’344 Betriebe zählt das Bundesamt für Statistik für 2022. Seit Jahrzehnten ist diese Zahl rückläufig. 1985 gab es in der Schweiz noch 98’759 Bauernbetriebe. In derselben Zeit hat sich die bewirtschaftete Fläche pro Betrieb in die Gegenrichtung entwickelt. Sie hat sich mehr als verdoppelt auf 21,6 Hektaren im Schnitt. Betriebe mit einer Fläche von mehr als 30 Hektaren haben in dieser Zeit deutlich zugenommen, von knapp 4000 auf über 11’300. Umgekehrt gibt es nur noch 7000 Betriebe, die fünf Hektaren und weniger bewirtschaften – 1985 waren es noch über 32’000. Eine Entwicklung, der sich die Kleinbauern Vereinigung entgegenstellt. Die gemeinnützige Bauern- und Konsument:innen-Organisation engagiert sich für mittlere und kleine Bauernbetriebe in der Schweiz.
Dabei geht es um den Erhalt der Vielfalt. In jeder Hinsicht. «Kleine Betriebe sind nicht per se nachhaltiger oder grosse weniger divers», sagt Patricia Mariani, Co-Geschäftsleiterin. «Aber die
Vielfalt der Betriebe an sich ist ein wichtiger Wert, den es zu erhalten gilt.» Denn jeder Hof ist individuell und setzt andere Prioritäten. Dagegen gleicht ein Gebiet, das von grossen Betrieben geprägt ist, einer industriellen Landwirtschaft und ist entsprechend aufgeräumter.

Sortenvielfalt

Die Vielfalt der Betriebe ist auch für Béla Bartha, Geschäftsführer Pro Specie Rara (PSR), ein wichtiges Kriterium. Die Stiftung setzt sich für den Erhalt traditioneller Sorten ein. Damit eine diese Vielfalt überhaupt gelingen kann, muss der Weg für den Anbau solcher Sorten erst geebnet werden. «Wir brauchen zuerst eine Vielfalt bei den Saatgutherstellern», sagt er.
Heute gebe es nur ein paar wenige grosse Produzenten. Sie für Saatgut traditioneller Sorten zu gewinnen, ist schwierig. Erschwerend kommt hinzu, dass in der Schweiz bis 2010 nur die in der offiziellen Sortenliste des Bundes aufgeführten Sorten im grossen Stil angebaut und vermarktet werden durften.
Stark reguliert
«Es gibt wohl keinen Bereich, der so stark geregelt ist wie der Saatgutbereich», sagt Béla Bartha und fügt an: «Bevor wir überhaupt über mehr Diversität auf dem Feld sprechen können, brauchen wir auch die Produzenten, die bereit sind, die benötigten Saatgutmengen zu produzieren, und die entsprechenden Rahmenbedingungen, dass entsprechende Sorten angebaut werden dürfen.» Er sieht deshalb die Bereitstellung eines vielfältigeren Sortenangebotes auch als gesellschaftliche Aufgabe. Heute gibt es neben den konventionellen auch alternative Anbausysteme, die besser geeignet sind, eine grössere Sortenvielfalt in die Produktion zu integrieren. «Sie sollten einfach an das Saatgut verschiedenster Sorten in guter Qualität kommen.» Damit sich die Produktion von Saatgut einer Sorte rechnet, braucht es eine gewisse Menge. PSR erreicht dies, indem sie verschiedene Produkte derselben Sorte in unterschiedlichen Kanälen anbietet. Von PSR gibt es nicht nur die Tomate im Regal von Coop. PSR bietet dieselbe Tomatensorte ebenso als Setzling auf dem PSR-Markt oder als Samen im Baumarkt an. Dass die alten Sorten beim Grossverteiler erhältlich sind, ist nicht selbstverständlich und auf den ersten Blick vielleicht auch fragwürdig. «Für Europa ist diese Kooperation zwischen einem Grossverteiler und einer Erhalterorganisation wohl einzigartig», sagt Béla Bartha. Er erachtet es für ihr Anliegen als enorm wichtig. Er sagt: «Man kann in Schönheit sterben oder man setzt sich diesem Dialog aus.» PSR will die Diversität für ein breites Publikum verfügbar machen. Dazu nutzt sie jeden Kanal, der sich ihr anbietet. Nur durch den Kontakt der Menschen mit der Vielfalt, beispielsweise bei ihrem täglichen Einkauf, kann auch eine Nachfrage erzeugt werden. Und diese trägt schliesslich zur Wirtschaftlichkeit von traditionellen Sorten bei. Trotz aller Anstrengungen bleibt eine Lücke, die über die Wertschöpfungskette finanziell schwierig zu füllen ist: Für den Sortenerhalt arbeitet PSR meist mit kleinen Saatgutmengen. «Wenn nun ein Landwirt Interesse an einer Sorte zeigt, müssen wir erst das Saatgut hochvermehren», sagt Béla Bartha. Das Vermehren eines Saatgutes bis zur erforderlichen Menge kann vier bis fünf Jahre dauern. «Das kann die Nachfrage ersticken», sagt er. Deswegen müsste PSR bereits zuvor von vielversprechenden Sorten eine angemessene Saatgutmenge produzieren und für allfällig interessierte Produzenten bereithalten, damit diese sofort mit der Produktion für den Handel beginnen können. Zudem gibt Béla Bartha zu bedenken, dass die Produktion grösserer Saatgutmengen auch dazu beiträgt, die Qualität der Sortenerhaltung zu steigern. Diese Vorinvestition lässt sich durch den Handel nicht refinanzieren und deshalb ist ProSpecieRara u. a. auch hier auf Stiftungsunterstützung angewiesen.
5600 Sorten
Den Erhalt von über 5600 traditionellen Sorten hat PSR mit ihrem Engagement gesichert. Dazu setzt sie auf ein Netzwerk von über 500 ehrenamtlichen Sortenbetreuer:innen, Bauern und Saatgutproduzenten. Sie sorgen für den Erhalt «on farm» (auf ihrem Hof oder in ihren Gärten). «Wir haben ca. ein Drittel aller Sorten jedes Jahr im Anbau», sagt Béla Barta. «Jedes Jahr vermehrt unser Netzwerk die Sorten, erneuert damit das Saatgut und schickt einen Teil an die Zentrale in Basel zurück.» Durch den wiederholten Anbau erhalten die Sorten die Möglichkeit, sich kontinuierlich an die sich stetig verändernde Umwelt anzupassen. «Sorten passen sich sogar an die Vorlieben der einzelnen Züchter an», sagt er, «denn alle, die sich für uns engagieren, egal ob auf einem grossen Feld oder im Garten, wählen die Pflanzen, von denen sie später Samen gewinnen wollen, nach einem gewissen Bild, wie sie diese Pflanzen gerne hätten, aus.» Diese individuellen Vorstellungen (Sortenbilder) sowie die Anbaumethoden prägen schliesslich das Aussehen und die Eigenschaften einer Sorte. Auch das regionale Klima spielt eine wichtige eine Rolle. In einem trockenen Jahr können sich Eigenschaften anders ausprägen als in einem feuchten Jahr. So verändert sich die Sorte stetig, auch wenn der Sortentyp durch ständige Auslese möglichst erhalten bleiben soll. Die «on farm»-Erhaltung ist damit etwas Dynamisches. «Diese Dynamik und Anpassungsfähigkeit wollen wir in unseren Populationen miterhalten», sagt Béla Bartha. Deswegen ist es für die Stiftung auch von Bedeutung, dass bei der Erhaltung viele Menschen mitwirken. PSR agiert hier nicht wie eine herkömmliche Genbank, welche die Samen auch vermehrt, dann aber einfriert und dann nur alle 50 Jahre wieder aus dem Gefrierer rausholt und damit die stetige Anpassung an die Umwelt unterbindet.

Altes Wissen bewahren.
Spannende Perspektive
Die Vielfalt bei den Produzenten hängt von einer vielfältigen Abnehmerschaft ab. Viele der kleinen und mittleren Bauernbetriebe verkaufen ihre Produkte direkt an die Konsument:innen, aber genauso an das lokale Gewerbe wie kleinere Dorfkäsereien, Metzgereien oder Restaurants. Einige sind sogar genossenschaftlich organisiert. Dies ermöglicht, sich ein wenig vom generellen Preisdruck der Grossverteiler abzugrenzen. Der Direktverkauf hat in den vergangenen Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. Haben 2010 noch 7000 Betriebe ihre Produkte direkt an die Konsument:innen vertrieben, so waren es im Jahr 2020 schon 12’600. Patricia Mariani ist überzeugt, dass er gerade für kleinere Betriebe eine spannende wirtschaftliche Perspektive darstellt. «Für geringe Mengen kann ein Hofladen genau der passende Kanal sein», sagt sie. «Ein grosser Hof hat deutlich mehr Menge. Der braucht mehr Frequenz, wenn er alles direkt absetzen möchte.» Gerade in der Pandemie erfreuten sich die Hofläden steigender Beliebtheit bei den Konsument:innen. Doch die Entwicklung zeigt auch die Grenzen des Kanals. Patricia Mariani weist darauf hin, dass Wunsch und Wirklichkeit zuweilen auseinanderklaffen. Denn nach der Pandemie ging die Nachfrage wieder zurück. Die Gründe können vielfältig sein. Der Besuch des Hofladens kann aufwändig und zeitraubend sein. Dennoch bieten alternative Kanäle Chancen. Abo-Angebote, bestellbar über das Internet, bieten den Bauern die Möglichkeit, ihre Produkte regelmässig und direkt an die Konsument:innen zu liefern. Mit Gastronomieangeboten können die Bauernbetriebe ihre Ware zusätzlich direkt auf dem Hof vermarkten.
Direkter Kundenkontakt
Neue Absatzkanäle bieten neue Möglichkeiten und stellen die Landwirt:innen vor neue Aufgaben. Patricia Mariani hält fest, dass der direkte Kundenkontakt dem Bauern auch liegen müsse. «Doch, wenn er das tut, hat er einen wichtigen Vorteil», zählt sie auf. «Er tritt in den direkten Austausch mit seinen Konsument:innen.» Diese können ihm Feedback und Wertschätzung geben. Und er erfährt mehr über ihre Vorlieben und Wünsche – oder auch einmal Kritik. Vor allem werden Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion erlebbar. Sie bleiben keine theoretischen Begriffe. Das ist entscheidend. Damit die Konsument:innen die Vielfalt nachfragen, müssen sie diese auch kennen. «Eine Veränderung des Konsumverhaltens ist nur so möglich», sagt Béla Bartha und verweist auf das Tomatensortiment in den Supermärkten. Vor 20 Jahren waren die Tomaten gleichförmig rund und rot. Heute gehören Cherrytomaten, Fleischtomaten oder gelbe Sorten zum alltäglichen Erlebnis im Sortiment. Und selbst eine Coeur de Boeuf ist heute keine Exotin mehr. «Man sagt, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht», sagt Béla Bartha. «Das ist bei den Konsumenten, die gerade bei der Ernährung eher konservativ sind, häufig auch so. Das ‹neue› Unbekannte in Form traditioneller und oft vergessener Sorten wieder anzubieten, braucht daher sehr viel Kommunikations- und Überzeugungsarbeit auf möglichst vielen Kanälen.»
Datenbank mit Wissen
Genau für dieses Wissen setzt sich Horst Lichtner, Geschäftsführer der Stiftung KEDA – Kulinarisches Erbe der Alpen ein. Diese betreibt das Culinarium Alpinum im Klostergebäude in Stans. Die Stiftung hat eine lebhafte Geschichte hinter sich. Erst 2016 gegründet, erlebte sie bereits einige Wechsel. Und Corona hat ihre Arbeit zusätzlich erschwert. Jahrelang versuchten unterschiedliche Teams eine Struktur zu finden, die funktioniert.

«Ich bin der dritte Geschäftsführer in nur drei Jahren», sagt Horst Lichtner. «Ich habe den Auftrag, alpine Kulinarik erlebbar zu machen.» Er zeigt sich optimistisch, dass die Entwicklung langsam, aber sicher in eine stabile Situation übergeht. Doch die Aufgabe bleibt anspruchsvoll. «Eigentlich sind wir ein Start-up», sagt er. Viele Projekte laufen. Das Culinarium Alpinum bewirbt sich etwa als Weltkulturerbe. «Das Culinarium Alpinum ist eine sehr komplexe Geschichte. Wir haben einen Gastronomiebetrieb ins Kloster gebaut, leben regionale Kulinarik und wir sind daran, dies in Richtung alpine Esskultur weiterzuentwickeln», sagt Horst Lichtner. Zudem ist das Team von Culinarium Alpinum daran, eine Wissensdatenbank aufzubauen. Noch stehen sie am Anfang. Aber der Geschäftsführer zeigt sich begeistert. «Es ist ein toller Weg», sagt er, «wir pflegen das Wissen der Regionalkulinarik, wir haben gewissermassen eine essbare Landschaft.» Dabei dreht sich das Wissen um alte Sorten, aber nicht nur. Genauso wertvoll ist das Wissen vom Anbau oder von der Zubereitung, wie es in überlieferten Rezepten vorhanden ist. Doch dieses Wissen zu finden und «haltbar» zu machen ist anspruchsvoll. «Viel dieses Wissens ist irgendwo überliefert, eventuell auch nur mündlich. Genau dieses Wissen wollen wir erhalten», sagt Horst Lichtner. Dies geht nur über zahlreiche Interviews direkt mit den Menschen.
Altes ist Potenzial für Neues
Dieses Wissen will das Culinarium Alpinum den Menschen zugänglich machen. «Unser Ziel muss es sein, die Leute neugierig zu machen», sagt Horst Lichtner. Noch sieht er Nachholbedarf. Noch seien die Menschen zu wenig neugierig, so seine Einschätzung. Dabei gibt es unzählige Geschichten, die darauf warten, entdeckt und erzählt zu werden. Das Steigerungspotenzial ist enorm. Doch braucht es eine Verhaltensänderung, um die Menschen für dieses Wissen zu begeistern. «Eine Verhaltensänderung zu erreichen, ist mitunter das Schwierigste», sagt er, «aber wir müssen den Mut haben, diesen Weg zu gehen.» Keine Veränderung sieht er nicht als Option. Schliesslich ist Essen ein bedeutender Teil im Leben. Jeden Tag verbringen wir Stunden mit Essen und Trinken. Es geht um Ernährung und Genuss, ein sehr emotionales Erlebnis. «Mit dieser Emotionalität können wir die Menschen abholen, begeistern, ihnen zeigen, dass es schmeckt, und sie riechen lassen», sagt Horst Lichtner. Er fordert eine Abkehr vom Supermarkt-Denken, in dem jeden Tag Erdbeeren in der Auslage liegen, unabhängig von der Jahreszeit. Das habe man einst als kulturellen Fortschritt gepriesen. «Wir müssen umdenken. Wir müssen Teil des Umdenkens werden», sagt er. «Nur so haben wir eine Zukunft für diesen Planeten.» Béla Bartha meint, dass die Lösungen für die Zukunft in den traditionellen Sorten aus der Vergangenheit gefunden werden können. Er weist darauf hin, dass einige alte Sorten Eigenschaften besitzen, die sie für neue Umweltbedingungen gar besser geeignet machen. Er denkt beispielsweise an Sorten aus dem Wallis oder dem Bündnerland, die kontinentale, trockene Sommer gewohnt sind. Alte Kohlsorten, die direkt über dem Boden ausladende Grundblätter ausbilden und so das Unkrautwachstum behindern und zwischen Boden und Blatt für ein feuchtes Mikroklima sorgen, das sie vor Austrocknung schützt, oder Getreide mit grossem Wurzelwerk, das in kurzer Zeit viel Wasser und Nährstoffe aufnehmen kann. Gerade diese Eigenschaften wurden aus Effizienzgründen häufig weggezüchtet, da sie durch künstliche Düngergaben und Bewässerung ersetzt wurden. «Es zeigt sich, die Pflege dieser alten Sorten macht Sinn. Es steckt viel Potenzial in ihnen, das unsere Ernährungssicherheit auch für die Zukunft garantiert.»