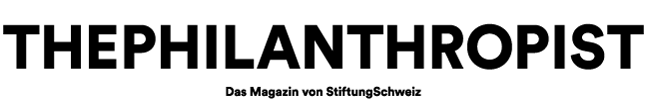Per Zufall sitze ich mit Rémy an einem sonnigen Herbsttag beim Mittagessen in unserem Fachspital an einem Tisch zusammen. Er ist ein charmanter Kerl mit einem ansteckenden Lachen und im Spital, um seine Medikamente abzuholen und sich durchchecken zu lassen. Es ist leicht, mit ihm ins Gespräch zu kommen, und mit einem Mal erzählt er mir seine Geschichte. Es sind Geschichten wie diese, da wird die Welt für einen Moment ganz still. Er war noch jung, als seine Frau und ihr gemeinsames Baby bei einem Verkehrsunfall ums Leben kamen. Am nächsten Tag, sagt er, war er auf dem Platzspitz – es war die Hoch-Zeit der offenen Drogenszene mitten in Zürich. Er nahm alles, was er finden konnte, um sich zu betäuben. Sein Leben so zu verlieren, wäre nur ein zusätzlicher Bonus gewesen. Sein Körper war jedoch zäh und so trieb er mehrere Jahre schwer drogensüchtig vor sich hin.
Bis er eines Tages auf dem Weg zu einem der Konsumräume der Stadt einen Kollegen traf, der einen Welpen auf dem Arm hatte – der Kollege wollte zum Tierarzt, den Kleinen impfen lassen. Selbst suchtkrank, gab er den Plan schnell auf und wollte sich Rémy auf dem Weg zum Drogencafé anschliessen.
Es ist eigentlich eine triviale Begegnung, es muss einige dieser Ereignisse in Rémys Karriere der letzten Jahre gegeben haben: Arzttermine, die von ihm oder Kollegen verpasst wurden, Familienbeziehungen, die abgebrochen wurden, Termine bei Beratungszentren, die verfielen.
An diesem Tag entschied sich Rémy, den Tierarztbesuch mit dem Welpen für seinen Kollegen zu übernehmen. Er kann mir auch sagen, was diese Begegnung von allen anderen Angeboten dieser Art unterschieden hat: «Weisst du, es war zum ersten Mal, dass Gott mir wieder ein Leben anvertraut hat, das nicht meins war. Mein eigenes war mir doch scheissegal gewesen.» Der Rest ist Geschichte: Der Kollege überliess ihm das Tier, der Hund würde bis zu seinem Tod zehn Jahre später bei ihm bleiben und Rémy schaffte den Schritt weg von Heroin und Selbstzerstörung.
Seine Erzählung hat nur wenige Minuten gedauert und doch hat sie alles verändert. Die Selbstverständlichkeit, mit der er lacht, und das Grundvertrauen, das er der Welt offensichtlich entgegenbringt, sind nur schwer zu fassen. Rémy sitzt mit uns am Tisch, quicklebendig, und diskutiert fröhlich die Frage, wie man die Cremerolle am besten isst, die es als Dessert gibt (nämlich ohne Besteck).
Resilienz ist in der letzten Zeit fast ein Zauberwort unserer Gesellschaft geworden. Ein Sehnsuchtsbegriff, der viele Hoffnungen in sich vereint. Wir leben in einer Zeit, in der wir bisweilen schon nach Worten für die rasche Koinzidenz gesellschaftlicher Krisen suchen müssen. Wir erleben eine Destabilisierung unserer Weltordnung, die von globalen Zusammenhängen bis zum eigenen Familiengefüge reicht. Wir bemerken es in unseren Auffangstellen an den auffällig vielen neuen Menschen, die sich bislang noch in der Gesellschaft halten konnten. In unserer Jugendnotschlafstelle haben wir zum ersten Mal seit Langem wieder Jugendliche, die intravenös konsumieren. Es kann jede und jeden treffen und die Sehnsucht nach einer Zauberformel, die uns in solchen Zeiten schützen kann, ist gross.
Wir wissen, dass es Dinge gibt, die Resilienz fördern: Selbstfürsorge, ein gesundes Abgrenzungsvermögen, ressourcenorientiertes Denken. Es sind sehr gut durchdachte und erforschte Instrumente. Und doch bleiben sie beim Individuum stehen. Rémys Rettung war seine Fähigkeit, sich nach Jahren der physischen und psychischen Erschöpfung wieder auf ein anderes Wesen einlassen zu können. Seine Rettung war ein Umfeld, das ihn gerade dann ge- und ertragen hat, als er in seiner Verzweiflung und seinem Hass auf diese Welt auch für sein Umfeld bisweilen vielleicht unerträglich war, und das ihm zur Seite stand, als er seine ersten Schritte aus der Sucht wagte.
Wir können für uns selbst und die Menschen, denen wir begegnen, jeden Tag einen Unterschied machen – wir wissen nur noch nicht, welcher es sein wird. Angesichts dieser Unverfügbarkeit, weder uns noch unsere Nächsten aufzugeben, ist für mich die eigentlich entscheidende Bedeutung von Resilienz: ihre soziale Dimension, die sie von einem Instrument der Selbstoptimierung in die Geheimwaffe einer Gemeinschaft verwandelt, die einander nicht aufgibt, unabhängig davon, wie die Chancen stehen mögen.