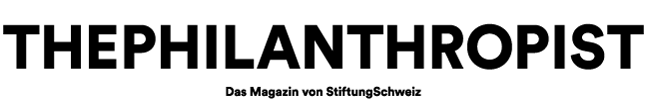The Philanthropist: Wie digital ist der Stiftungssektor in der Schweiz?
Georg von Schnurbein: Stiftungen sind Teil der Gesellschaft und weisen eine ähnliche Entwicklung auf. Wir haben unheimlich viel Know-how in der Schweiz und auch Stiftungen wie die Botnar Foundation, die das unterstützen. Die Grundlagen sind gegeben. Man kann sehr weit sein. Aber die grosse Masse beschäftigt sich noch nicht mit dem Thema.
Das klingt sehr statisch. Sie leiten seit der Gründung 2008 das Center for Philanthropy Studies (CEPS) der Universität Basel. Hat sich der Stiftungssektor seither denn überhaupt gewandelt?
Wenn man so nah dran ist, nimmt man Veränderungen zuerst gar nicht so wahr. Aber es hat sich sehr viel getan. Schon seit 2003 beschäftige ich mich mit Stiftungen. Die Hälfte der heute existierenden Stiftungen sind in dieser Zeit überhaupt erst entstanden. Neue Formen wie die Dachstiftung oder die Verbrauchsstiftung haben sich etabliert. Das heisst, wir haben heute einen ganz anderen Sektor als noch vor 15 Jahren. Es gibt neue Akteure, Plattformen und Magazine.
Weshalb gab es diese zahlreichen Neugründungen?
Geld spielt natürlich eine Rolle. Hochphasen der Philanthropie fallen immer in Hochkonjunkturphasen.
Und dann werden Stiftungen gegründet?
Ja. Das war von 1890 bis 1914 der Fall genauso wie jetzt seit 1990. Wir haben die Anzahl Stiftungs-Neugründungen mit der Entwicklung des SMI verglichen. Die Entwicklung verläuft ziemlich parallel. Heute sehen wir eine Abschwächung der Konjunktur und ebenso einen Rückgang bei den Neugründungen.
Die Gesamtheit der philanthropischen Leistungen ist noch zu wenig sichtbar.
Georg von Schnurbein
Sind also die Finanzen das grosse Thema?
Die Frage, wie ich mein Geld anlege, ist gerade für kleine Stiftungen heute eine grosse Herausforderung. Diese haben keine grosse Risikofähigkeit. Sie stecken Verluste nicht einfach weg. In den Medien dagegen ist meist von den grossen Stiftungen die Rede. Dies erweckt den Eindruck, dass Stiftungen viel Geld haben. Doch 80 Prozent der Stiftungen besitzen weniger als drei Millionen Franken. Bedenken Sie, dass diese oft nur mit dem Ertrag arbeiten. Ziehen Sie noch alle Verwaltungskosten ab, dann bleibt nicht viel Geld für die Projekte. Doch es gibt ein wesentlich grösseres Problem. Der Nachwuchs an Stiftungsrätinnen und ‑räten. In der Boomphase zwischen 1995 und 2010 sind viele Stiftungen entstanden. Diese kommen jetzt in die Phase, in der die Gründerinnen und Gründer sowie ihre Freunde in ein Alter kommen, in dem sie zurücktreten wollen. Wir brauchen Ersatz.
Wie viele?
Wir haben in der Schweiz rund 70’000 Stiftungsratsposten. Rund 63’000 Personen besetzen diese. Das heisst, dass nur selten eine Person mehr als ein Stiftungsratsmandat hat. Um ausscheidende Stiftungsräte zu ersetzen, braucht es rund 5000 neue Stiftungsräte pro Jahr. Die 300 Stiftungsneugründungen schaffen ebenfalls nochmals 1500 Stiftungsratspositionen. Die Suche nach dem freiwilligen Engagement, das es hier braucht, lässt sich nicht monetär lösen.
Könnte die Digitalisierung helfen?
Natürlich. Schon nur beim Matching. Es gibt viele Menschen, die sich gerne engagieren würden, aber nicht wissen wo oder wie.
Gleichzeitig kann sie auch ein Hindernis sein. Junge Kandidatinnen und Kandidaten sind sich digitale Arbeitsweisen gewohnt, wie sie in traditionellen Stiftungen vielleicht noch nicht Einzug gehalten haben.
Das ist keine Frage der Digitalisierung. Jede Generation hat ihre eigene Arbeitsweise. Das war schon früher so. Der Generationenwechsel wird die Digitalisierung bringen.
Aber es gibt sie noch, die Stiftung, deren Ablagesystem in Kisten funktioniert?
Die gibt es. Und wir sehen auch, wie diese an ihr natürliches Ende gelangen. Und dies nicht, weil der Stiftungszweck erfüllt ist, sondern weil sie organisatorisch nicht mehr überlebensfähig sind.
Die Digitalisierung könnte ihnen helfen, effizienter zu werden.
Das kann sie. Allerdings muss man auch beachten, dass die Stiftungsführung heute nicht dieselbe ist wie vor 20 Jahren. Die Anforderungen der Aufsicht sind viel höher. Das frisst Effizienzgewinne wieder weg. Die Stiftungsführungen brauchen deswegen zwingend neue Lösungen – und bei der Digitalisierung stehen wir noch am Anfang. Allerdings muss man auch berücksichtigen, die Stiftung gibt es nicht. Es gibt Stiftungen, die schon sehr digital unterwegs sind, gerade junge Stiftungen. Ich kenne eine, die hat die Geschäftsstelle aufgelöst und arbeitet nur noch mit Online-Tools.
Braucht es eventuell gewisse Stiftungen auch nicht mehr? Mit Crowdfunding beispielsweise stehen alternative Finanzierungsformen zur Verfügung.
Neue Formen sind keine Konkurrenz. Das ist überhaupt kein Problem, wenn gewisse Gesuche nicht mehr zu Stiftungen gelangen. Im Gegenteil. Es ist gut, wenn mehr Geld zur Verfügung steht.
Könnten Stiftungen Crowdfunding selbst nutzen?
Es gab schon Versuche, dass eine Stiftung sagte, wenn ihr 15’000 Franken sammelt, verdoppeln wir den Betrag. Das ist eine Win-win-Situation. Oder sie machen eine Anschlussfinanzierung, nachdem die Crowd den Start finanziert hat. Stiftungen sind offen. Allerdings übersteigt gerade bei grossen Stiftungen die Anzahl Gesuche die vorhandenen Mittel. Deswegen sind sie zurückhaltend, sich in zusätzliche Entscheidungsprozesse einzubinden.
Aber die Crowd könnte helfen, die Projektauswahl breit abzustützen.
Die Demokratisierung der Philanthropie ist ein spannendes Thema. Sie kann eine Möglichkeit sein. Problematisch wird es allerdings bei der Frage der Verantwortung. Hier sind Grenzen gesetzt. Der Stiftungsrat bleibt am Ende für alle Entscheide verantwortlich – ob die Crowd mitbestimmt oder nicht. Er muss das letzte Wort haben. Aber es gibt Stiftungen, die schon sehr offen sind und beispielsweise über Beiräte öffentlich mitbestimmen lassen.
Aber müssten Stiftungen nicht sowieso nach Transparenz streben?
Bevor Transparenz als Selbstzweck propagiert wird, sollte geklärt werden, was der Standard ist. Dass sie so transparent sein sollen wie ein börsenkotiertes Unternehmen, halte ich für überzogen. Im Vergleich zu mittelständischen Unternehmen stehen sie dagegen gar nicht so schlecht da. Gewiss, aufgrund der Gemeinnützigkeit hat ihre Arbeit einen öffentlichen Bezug. Aber deswegen unterstehen sie auch der Stiftungsaufsicht. Transparenz ist wichtig für die Entwicklung des Sektors, und dazu tragen wir mit unserer Forschung bei.
Transparenz hätte zumindest einen positiven Effekt auf das Image?
Legitimation und Reputation sind in der Tat grosse Herausforderungen. Wir sehen das aktuell in Frankreich mit den Grossspenden nach dem Brand der Notre-Dame. Gegenüber diesen Megaspendern gab es schon immer eine kritische Haltung. In Frankreich war es auch bis 1983 verboten, Stiftungen zu gründen, aus dem Gedanken heraus: Es widerspricht dem Prinzip der Gleichheit, wenn jemand mit viel Geld damit das Leben anderer beeinflusst.
Und doch will man ja einfach Gutes tun?
Aber was das heisst, welchen Nutzen die Philanthropie bringt, diese Frage wird heute meist anekdotisch beantwortet, etwa im Sinn, das war ein schönes Projekt. Aber die Gesamtheit der philanthropischen Leistungen ist noch zu wenig sichtbar. Das sehe ich als Forschungsaufgabe. Wir müssen durch Daten, durch Aufzeigen von Finanzierungsströmen belegen, was der Sektor überhaupt leistet, was Erfolg ist. Und dann müssen wir natürlich lernen, über Misserfolge zu reden. Die Wirkungsmessung wird dazu führen, dass wir nicht alles als Erfolg darstellen können, nur weil wir Gutes tun. Doch genau das ist heute Usus. In Jahresberichten von Stiftungen ist immer alles gut. Die Probleme liegen in der Gesellschaft. Aber selten sagt eine Stiftung, das hat nicht funktioniert.
Sollen sich Stiftungen denn überhaupt in den gesellschaftlichen Diskurs einmischen?
Stiftungen sind wie jede andere Institution Teil dieser Gesellschaft. Weshalb sollten ausgerechnet sie sich nicht einmischen dürfen? Bisher hat man sich zwar wirklich eher zurückgehalten. Aber es gibt heute eine aktivere Form. Stiftungen wollen nicht mehr nur Mittel zur Verfügung stellen, sie wollen auch selbst am Diskurs beteiligt sein. Ich denke, das ist legitim.
Prof. Dr. Georg von Schnurbein ist Associate Professor für Stiftungsmanagement und Direktor des Center for Philanthropy Studies (CEPS) der Universität Basel, das er aufgebaut hat und seit 2008 leitet. Initiiert wurde das CEPS von SwissFoundations, dem Verband der Schweizer Förderstiftungen. Von Schnurbein publiziert zu den Themen Stiftungswesen, Governance, Nonprofit-Management, Marketing und Philanthropie. Studiert hat er an den Universitäten Bamberg, Fribourg und Bern Betriebswirtschaftslehre mit Nebenfach Politikwissenschaften. Von 2011 bis 2017 war er Vorstandsmitglied des European Research Networks on Philanthropy (ERNOP).