Die Gesellschaft soll Herausforderungen wie Potenziale technischer Neuerungen oder Umweltveränderungen kennen, mit ihnen umgehen können und Lösungen entwickeln: Diese Ziele verfolgt die Stiftung Risiko-Dialog seit über 30 Jahren.
Mitte der 1980er-Jahre: Es ist die Zeit der grossen Unfälle von Tschernobyl und Schweizerhalle. Zeitgleich warnt der deutsche Soziologe Ulrich Beck in seinem viel beachteten Buch «Risikogesellschaft» vor den Gefahren, die der technische Fortschritt mit sich bringe. Matthias Haller, damals Professor für Risikomanagement und Versicherung an der Universität St. Gallen, wollte diese Diskussion nicht einfach den Fachexpert:innen überlassen. Für ein wirksames Risikomanagement müsse sich vielmehr die Gesamtgesellschaft einbringen können. In der Folge gründete er 1989 die gemeinnützige Stiftung Risiko-Dialog. Bis heute arbeitet die in Zürich ansässige Organisation eng mit Partner:innen aus Forschung, Wirtschaft, Verwaltung und Politik sowie Zivilpersonen zusammen.
Befasste sie sich in ihren Anfängen vor allem mit Risiken der Nuklear- und Chemieindustrie, der Gentechnologie und des Mobilfunks, fokussiert sie sich heute auf die drei Tätigkeitsfelder «Klima und Energie», «Risikokompetenz und Resilienzkultur» sowie «Digitalisierung und Gesellschaft». Nicht verändert hätten sich aber die Ziele der Stiftung, sagt Geschäftsführer Matthias Holenstein: «Wir wollen einen Beitrag leisten, damit die Gesellschaft aktuelle Chancen und Herausforderungen kennt und lernt, mit ihnen umzugehen.» Dabei will die Stiftung nicht nur Probleme benennen, sondern auch eine Plattform bieten, um gemeinsam Lösungen zu entwickeln und die Zukunft zu gestalten.

Digitalisierung beeinflusst

«Digitalisierung und Gesellschaft» sei seit 2018 ein Schwerpunkt innerhalb der Stiftung, erklärt Projektleiterin Anna-Lena Köng: «Die Veränderungen, die sich durch die Digitalisierung ergeben, beeinflussen zunehmend alle Lebensbereiche, und es braucht eine gesellschaftliche Auseinandersetzung dazu.» Beim Aufbau dieses Tätigkeitsfeldes – insbesondere bei der Durchführung des DigitalBarometers – wird die Stiftung von «die Mobiliar» finanziell unterstützt; ansonsten finanziert sie sich durch die Projekte, die sie gemeinsam mit Partner:innen realisiert.
Der DigitalBarometer erscheint seit 2019 jährlich. «Er ist für uns ein wichtiges Messinstrument, um zu verstehen, wo die Bevölkerung im Bereich Digitalisierung Risiken und Chancen wahrnimmt, wo und auf welche Art sie sich einbringen möchte und wem sie Verantwortung zuweist», sagt Anna-Lena Köng. Mit der Zeit hätten sich drei Kernthemen herauskristallisiert: digitale Daten, digitaler Meinungsbildungsprozess und die Zukunft der Arbeit. Daraus ergeben sich konkrete Projekte wie «Digital Literacy». Bei dieser Simulation lernen die Teilnehmenden den Einfluss von Falschinformationen im digitalen Raum auf ihre Meinungsbildung zu erkennen und zu hinterfragen. Dem Umgang mit persönlichen Daten widmet sich das Projekt «Datenspende für Gemeinnützigkeit». Dieses hatte die Stiftung ein erstes Mal mit der Universität Zürich im Alltag getestet: Im Rahmen der Pandemie-Massnahmen stellten Studierende dem Uni-Krisenstab und der Forschung freiwillig persönliche Daten zur Verfügung, die für den Umgang der Pandemie relevant waren, beispielsweise
zum Impfstatus oder zum psychischen Wohlbefinden. 1800 Studierende und Mitarbeitende der Uni Zürich spendeten ihre Daten. «Um diese hohe Mitmachquote zu erreichen, war eine kommunikative Begleitung zentral», sagt Matthias Holenstein. Das Beispiel zeige, dass die Menschen bereit seien, ihre Daten für einen «höheren Zweck» preiszugeben, sofern es freiwillig geschehe und jederzeit widerrufbar sei. Zudem sei das Vertrauen der Schweizer Bevölkerung in gemeinnützige Organisationen und Behörden allgemein hoch, so Matthias Holenstein.
Themen der Zukunft
Künstliche Intelligenz, die Kollaboration von Mensch und Roboter in der Arbeitswelt sowie die Auswirkungen der Digitalisierung auf die psychische Gesundheit gehören zu den Themen, welche die Bevölkerung gemäss Anna-Lena Köng künftig stark beschäftigen werden. Die Stiftung werde prüfen, welche Art von Projekten sie umsetzen könne, um die Bevölkerung in der digitalen Transformation zu unterstützen. Matthias Holenstein: «Wir stellen fest, dass die drei Tätigkeitsfelder der Stiftung immer mehr Synergien aufweisen.» Das sei ein Abbild der Realität: «Schliesslich sind wir alle sowohl vom Klimawandel als auch von der digitalen Transformation betroffen und müssen eine Resilienzkultur entwickeln.»
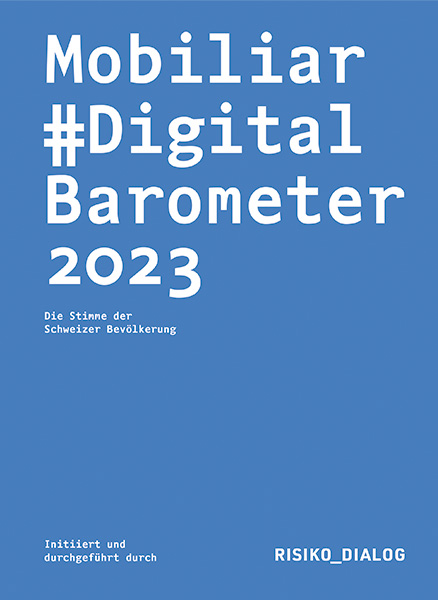
Jährlich zeigt der Digital- Barometer, wo die Schweizer Bevölkerung beim Thema Digitalisierung steht.


