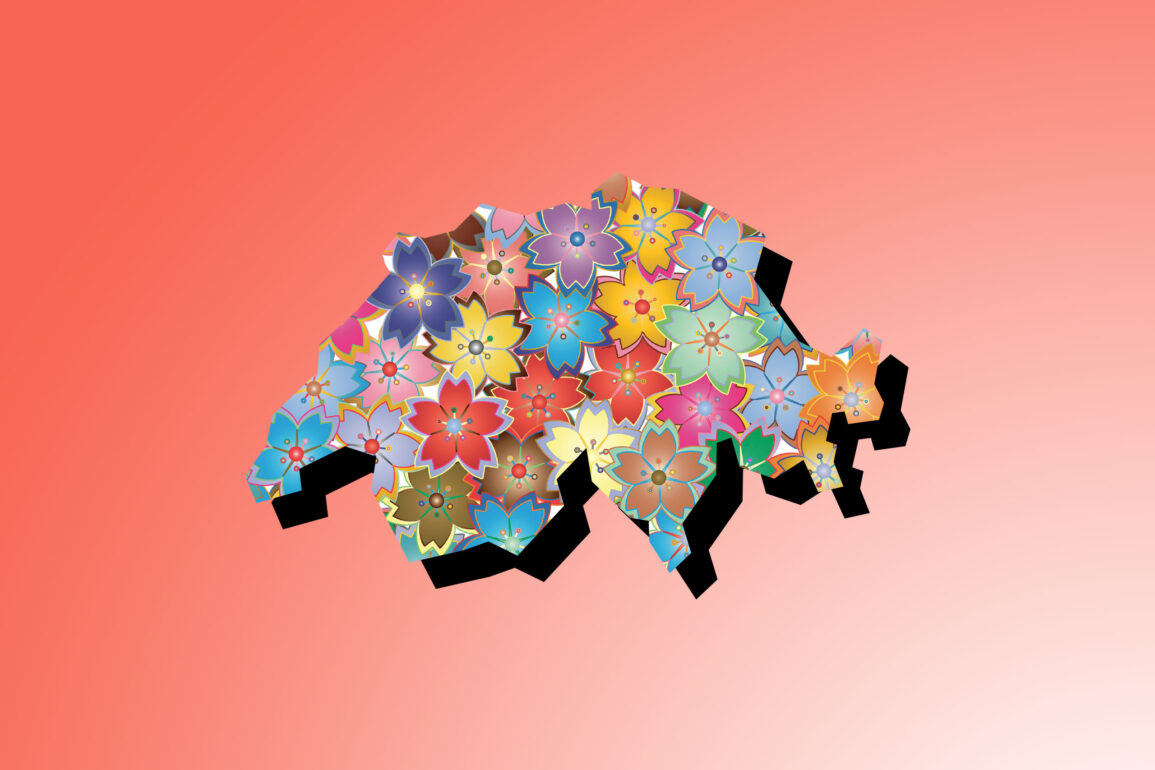Weltweit sorgen demokratiefeindliche Entwicklungen für Schlagzeilen. Gesellschaftlicher Zusammenhalt muss stetig aufs Neue erarbeitet werden. Neu ist diese Erkenntnis nicht, was die aktuelle Entwicklung keineswegs relativieren soll. Aber es zeigt, dass es bestehende und gelernte Massnahmen gibt. Auch der Föderalismus will gepflegt und weiterentwickelt sein. In der Schweiz tragen immer wieder neue Initiativen dazu bei. Um aktuelle Fragestellungen und Herausforderungen zu behandeln, hat die 1810 gegründete Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft SGG im Jahr 2022 den Think + Do Tank Pro Futuris lanciert. Als Experimentierraum soll er die Demokratie stärken. Dasselbe Ansinnen motivierte fast gleichzeitig auch Nationalrätin Natalie
Imboden. Sie regte in einer Motion an, zum 175-Jahre-Jubiläum der Bundesverfassung eine Demokratielabor-Stiftung für die Zukunft zu schaffen. Diese Bestrebungen reihen sich in bestehende Initiativen ein, die sich um den nationalen Zusammenhalt und die Pflege der Demokratie sorgen. Bereits 1914 stiessen Westschweizer Intellektuelle die Gründung der neuen helvetischen Gesellschaft NHG an. Sie sahen am Vorabend des ersten Weltkrieges den inneren Frieden der Schweiz zwischen Deutsch- und Westschweiz gefährdet. Viele Jahre später, 1967, hat die NHG zusammen mit den Kantonen die «ch Stiftung für die eidgenössische Zusammenarbeit» gegründet. Auslöser war die Einschätzung, dass sich die Kantone «nicht zu einer wirklichen Zusammenarbeit aufraffen können», zitiert die Festschrift zum 50-Jahre-Jubiläum den Schweizer Journalisten Hans Tschäni.
Längerfristige Arbeit
Mit dieser Stiftung können die Kantone die Zusammenarbeit fördern. Seit ihrer Gründung hat sie verschiedene Projekte angerissen und gepflegt. So vergibt sie den Föderalismuspreis, und diesen März hat sie die Fachkonferenz Citoyenneté zum Erfahrungsaustausch der Kantone zu politischer Bildung lanciert. Im Sinne des angestrebten kulturpolitischen Brückenschlags bietet sie seit 1976 mit dem Programm Premier Emploi stellenlosen Hochschulabsolvent:innen eine Praktikumsmöglichkeit in einer anderen Sprachregion. Die Stiftung ist das ideale Gefäss, um die Zusammenarbeit der Kantone zu fördern und Projekte im Sinne aller 26 umzusetzen.
«Die ch Stiftung kann sich ungeachtet der politischen Aktualitäten den längerfristigen Aufgaben annehmen: der Pflege der sozialen Kohäsion und der Weiterentwicklung des Föderalismus», sagt die Staatsrätin des Kantons Neuenburg Florence Nater, Präsidentin des Stiftungsrates. Dabei funktioniert sie komplementär zur Konferenz der Kantonsregierungen KdK und zu den Direktorenkonferenzen.

Letztere betreiben Treffen der kantonalen Departementsdirektor:innen zu einem spezifischen Thema. Die KdK ist das Gremium aller Kantonsregierungen. Die Stiftung dagegen mischt sich weniger in Alltagsthemen ein. Sie leistet Grundlagenarbeit. «Die Stiftung will die Vielfalt in der Schweiz sichtbar machen, Impulse geben, die in Politik und Gesellschaft aufgenommen und weiterentwickelt werden», sagt Florence Nater.
Stärke des Föderalismus
«Föderalismus ist zunächst ein Mittel, um in Vielfalt zu leben – mit verschiedenen Sprachen, Kulturen und unterschiedlichen regionalen Realitäten – und, um gleichzeitig eine Einheit zu bilden», sagt Florence Nater. Er ermöglicht das Zusammenleben, ohne die regionalen Eigenheiten aufzugeben. Doch es braucht eine gemeinsame Basis; Solidarität, Konsensorientierung und Subsidiarität. Die Schweiz ist eine Einheit und dabei nicht trotz, sondern gerade dank ihrer Unterschiede so erfolgreich. Die föderale Zusammenarbeit, wie sie in der ch Stiftung gepflegt und gefördert wird, beruht auf der Vielseitigkeit und Nähe zur Bevölkerung.
«Eine der grossen Stärken des Föderalismus besteht darin, dass Entscheide nicht irgendwo in einem politischen Zentrum getroffen werden, sondern nah bei der Bevölkerung, dort, wo sie direkte Auswirkungen zeigen und wo die Möglichkeit besteht, teilzunehmen», sagt Florence Nater. Auch der Politgeograf und Geschäftsführer des Forschungsinstituts Sotomo Michael Hermann sieht den Vorteil des Föderalismus darin, dass er Lösungen nahe bei den Bürger:innen ermöglicht.

Regional unterschiedlichen Bedürfnissen, etwa von ländlichen Gegenden und urbanen Zentren, kann so Rechnung getragen werden. Dabei erkennt Michael Hermann im Schweizer Föderalismus eine Stärke, die er mit einer Schwäche des Konzepts begründet. Die Grenzen der Kantone verlaufen nicht entlang der Sprachgrenzen, weshalb einige Kantone mehrsprachig sind. Und genau dies sieht Michael Hermann als Vorteil gegenüber bspw. dem belgischen Föderalismus, in dem die Teilung entlang der Sprachgrenze verläuft und so die Gegensätze verstärkt. Der Schweizer Föderalismus bietet dagegen einen Beitrag zum Zusammenhalt, wobei es helfe, dass er nicht nur in Deutschschweizer:innen und Westschweizer:innen einteilt, sondern dass er zusätzlichen Identitätsbezug ermögliche, wenn eine Person Zürcher:in, Appenzeller:in oder Walliser:in sei, sagt Michael Hermann. Aber er sieht noch einen zweiten wesentlichen Vorteil des föderalen Systems: einen Wettbewerb der Ideen. Jeder Kanton kann eigene Lösungen finden. «Auf Kantonsebene ist die Idee des kompetitiven Lernens von den Lösungen der anderen ausgesprochen wichtig», sagt er. «Erst im Austausch merkt man, was andere machen, wo sie anstossen und wo sie erfolgreich sind.» Einen Vorteil, den auch Florence Nater nennt: «Die Schweiz ist ein grosses Laboratorium für Ideen, aber vor allem auch für konkrete Lösungsansätze. Der Föderalismus ermöglicht Experimente in Echtzeit, in Vielfalt zu leben, bei allen Unterschieden: zwischen Regionen, zwischen Bevölkerungen unterschiedlicher Herkunft, zwischen Geschlechtern», sagt Florence Nater. «Jede Gemeinde und jeder Kanton macht Erfahrungen und im gegenseitigen Austausch setzen sich idealerweise die guten Lösungen durch. Föderale Vielfalt ist ein Reichtum, kein Defizit.» Dennoch. Der Wettbewerb und die Unterschiede sind auch herausfordernd. Um die Mobilität über die Kantonsgrenze zu ermöglichen, sind Harmonisierungen notwendig, beispielsweise im Gesundheitswesen oder im Bildungssystem.
«Auf Kantonsebene ist die Idee des kompetitiven Lernens von den Lösungen der anderen ausgesprochen wichtig.»
Michael Hermann, Geschäftsführer des Forschungsinstituts Sotomo
Agieren wie Partner:innen
Harmonisierungen brauchen eine Konsensorientierung und ein gemeinsames Verständnis, ähnlich wie in einer kollaborativen Zusammenarbeit. Im föderalen Zusammenspiel hat es eine geringere Regulierungsdichte als auf Bundesebene. Weil nicht einfach ein Gesetz abgelesen werden kann, bekommt die menschliche und zwischenmenschliche Komponente mehr Gewicht. Das System verlangt mehr Diskussionen und Menschenverstand. Die Zusammenarbeit erfolgt gleichberechtigt. An den Konferenzen agieren die Kantone wie Partner:innen, die alle verschiedene Verwaltungskulturen, Systeme und Traditionen vertreten. Die Unterschiede sind nicht immer direkt übertragbar. «Es braucht Kulturübersetzer:innen, Kulturdolmetscher:innen», sagt Michael Hermann. Dieser Austausch und Abgleich ist für den Informationsfluss wichtig, auch gegen aussen. Ist dieser blockiert, sieht Michael Hermann das Risiko der Intransparenz. Das wirkt dem Vertrauen entgegen. Hier verortet er eine potenzielle Schwäche des Föderalismus, weil Transparenz aktiv gepflegt werden muss. «Es reicht nicht, dass man nicht verdeckt», sagt er. 26 unterschiedliche kantonale Lösungen werden intransparent, wenn sie nicht vergleichbar sind. Informationen müssen harmonisiert werden. Deswegen gehört zum Föderalismus das aktive Bestreben, durch Vergleichbarkeit Transparenz zu schaffen und damit Vertrauen aufzubauen. Föderalismus bedarf der steten Pflege, der Schaffung von Transparenz und des regelmässigen Austausches. Er ist kein starres Konstrukt. «Er muss – wie das gesamte politische System – stets konstruktiv-kritisch hinterfragt und bei Bedarf weiterentwickelt werden», sagt Florence Nater. «Hier braucht es eine Offenheit für zukunftsgerichtete Lösungen.» Das klingt nach viel Aufwand, bringt aber vor allem mehr Chancen.
«Die ch Stiftung kann sich ungeachtet der politischen Aktualitäten den längerfristigen Aufgaben annehmen: der Pflege der sozialen Kohäsion und der Weiterentwicklung des Föderalismus.»
Florence Nater, Präsidentin des Stiftungsrats der ch Stiftung
Die Chancen wahrnehmen
Gerade in den vergangenen Jahren stand der gelebte Föderalismus unter Druck und ein Hang zu zentralisierten Lösungen wurde erkennbar. «Aber auf der institutionellen Ebene ist der Föderalismus in der Schweiz fest verankert», hält Florence Nater fest. Um diesen weiter zu entwickeln, zu fördern und zu stärken, bietet die ch Stiftung Weiterbildungsveranstaltungen zum Föderalismuswissen an. Mit einem eigenen ch Blog will sie die Diskussion über die Chancen und Herausforderungen föderaler Lösungen animieren. Die Beiträge thematisieren konkrete, für den Föderalismus relevante Themen wie die Digitalisierung, die Medienförderung oder das Krisenmanagement. Föderalismus muss gepflegt werden. Das war die Absicht der Stiftungsgründung und ist heute genauso aktuell wie damals. Florence Nater sagt: «Aus Sicht der Kantone wird es daher in der nächsten Zeit auch darum gehen, der Bevölkerung den konkreten Nutzen und die Vorteile föderaler Lösungen in Erinnerung zu rufen, als Versprechen des Respekts für Vielfalt und als Instrument des nationalen und sozialen Zusammenhalts.»