Die Sorge für Menschen der älteren Generation ist traditionell ein Sektor, in dem viele Stiftungen aktiv sind. Mit dem aktuellen demografischen Wandel gewinnt das Engagement zusätzlich an Bedeutung. Denn wir werden immer älter. Und die Älteren werden mehr. Diese neue Situation fordert die gesamte Gesellschaft.
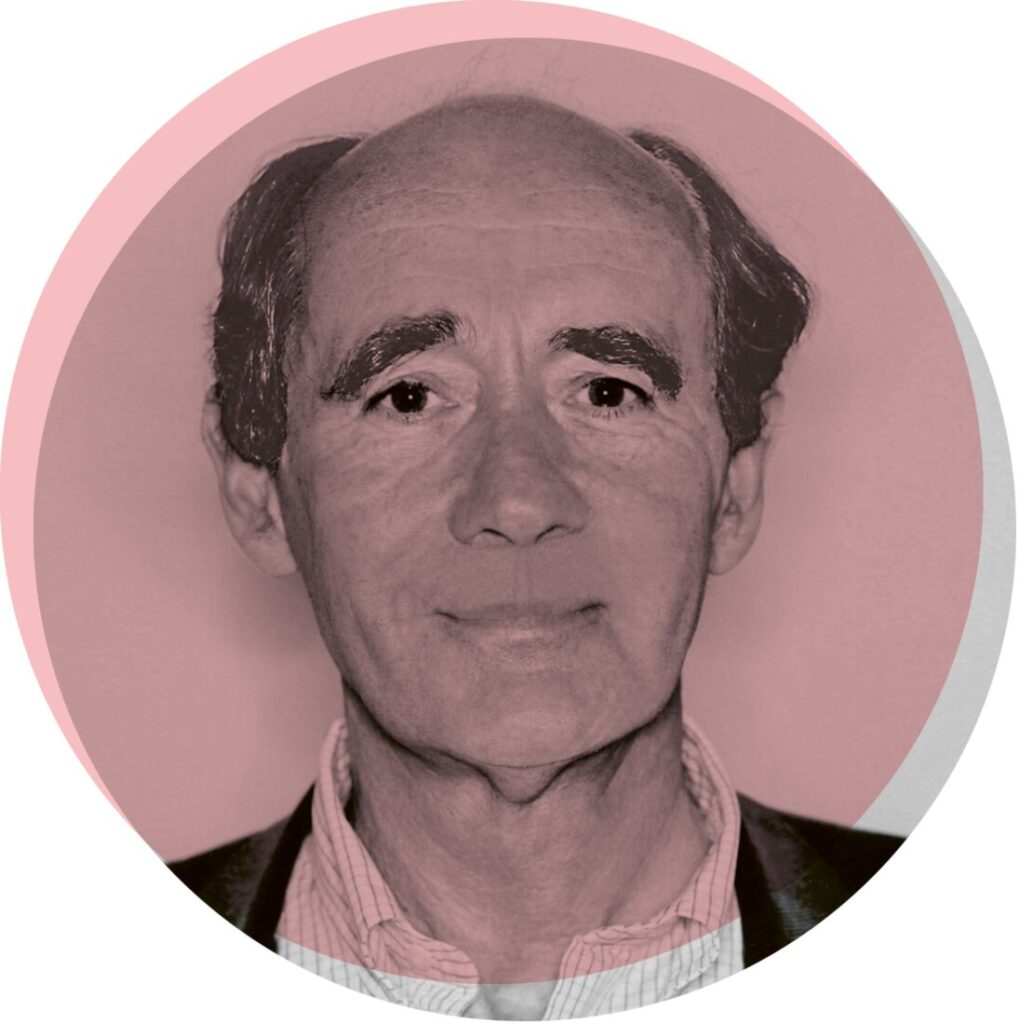
«Das Herz wird nicht dement», sagt Beat Hänni, Präsident des Stiftungsrates.
Die Stiftung Humor & Gesundheit unterstützt seit gut 15 Jahren Initiativen und Projekte, die mit einfühlsamem und respektvollem Humor die Lebensqualität von betagten, behinderten und demenzbetroffenen Menschen erhöhen. Der Stiftungsrat folgt im Stiftungszweck der Erkenntnis der heilsamen «therapeutischen» Wirkung des Humors zum Wohl der psychischen und körperlichen Gesundheit des Menschen. Humor in ein Alters- und Pflegeheim zu bringen, ist eine anspruchsvolle und heikle Herausforderung. Es ist immer eine Gratwanderung. Die geistig agilen Menschen sollen sich ebenso wiederfinden wie jene, deren intellektuelle Fähigkeiten nachgelassen haben. Denn gerade für demente Personen ist die Wirkung von Humor nicht zu unterschätzen. Lächeln, Lachen und Aufleuchten helfen. «Speziell geschulte Begegnungsclowns wissen und spüren sehr genau, wie sie die Sinne von dementen Menschen noch ansprechen können. «So wird gesprochen, berührt, musiziert und mit Mimik gespielt», erklärt Beat Hänni. «Der Hörsinn und die optische Wahrnehmung lösen Gefühle aus. Und oft sind auch Langzeiterinnerungen noch sehr präsent.» Dieser feine Humor erlaubt es, mit Mitmenschen Kontakt aufzunehmen, sie zu berühren, zu beglücken, wenn andere Wege schwierig geworden sind.
Wachsende Gruppe
Die Frage nach dem richtigen Altern ist facettenreich. Ihre Beantwortung wird für unsere Gesellschaft weiter an Bedeutung gewinnen. Sie wird Staat und Wissenschaft, Wirtschaft, NPOs und Stiftungen fordern.

Nicht Konkurrenzdenken, sondern sich ergänzendes Engagement ist gefordert. «Ich sehe vor allem ein Miteinander», sagt Maja Nagel Dettling von der Paul Schiller Stiftung.
Die philanthropische Institution setzt sich für eine gute Betreuung älterer Menschen in der Schweiz ein. Sie engagiert sich insbesondere dort, wo der Staat nicht oder noch nicht aktiv ist. «Wir sehen uns als ausgleichende Kraft. Wir haben finanzielle Ressourcen und sind im Vergleich zum Staat oder zu der Privatwirtschaft unabhängig», sagt sie. Dies ermöglicht der Stiftung ein agileres Handeln. Stiftungen können eigenständig Probleme auffinden, definieren lassen und Lösungen finden. Gerade in der Altersfrage ist dies dringend notwendig. Politische Reformen stecken fest. Die demografische Entwicklung macht es zwingend, zeitnah Antworten zu finden. Das Referenzszenario des Bundesamts für Statistik geht davon aus, dass bis 2045 ein Viertel der Bevölkerung über 65 Jahre alt sein wird – 2015 lag der Anteil noch bei 18 Prozent. Betrug die Lebenserwartung einer 65-jährigen Frau im Jahre 1998 noch 20,6 Jahre, durfte sie 2018 schon mit 22,7 zusätzlichen Jahren rechnen. Auch bei den Männer stieg die durchschnittliche Lebenserwartung nach der Pensionierung gemäss dem Bundesamt für Statistik auf 19,9 Jahre. Dies entspricht 3,4 Jahren mehr als Ende des 20 Jahrhunderts. Grundsätzlich ist ein gewonnenes Lebensjahr positiv. Jedoch ist mit dieser Veränderung eine grosse gesellschaftliche Herausforderung verbunden, denn mit der zunehmenden demografischen Umverteilung zwischen erwerbstätiger Bevölkerung und Pensionierten betreten wir Neuland.

Die Geschäftsführerin der Age-Stiftung, Antonia Jann, erklärt: «Wir kommen in eine Situation, die wir schlicht nicht kennen. Wir werden immer älter und die Älteren werden immer mehr. Gleichzeitig bleiben die Menschen länger selbständig. Es gibt dafür keine historischen Vorbilder.» Die Wahrnehmung unserer Gesellschaft ist geprägt von früheren Strukturen, die es nicht mehr gibt.
In der enormen Herausforderung des Themas sieht Antonia Jann aber auch eine Chance. «Wir müssen neu denken und andere Lösungen finden. Denn die bisherigen funktionieren unter den neuen demografischen Bedingungen nicht mehr problemlos.» Die Age-Stiftung widmet sich, wie vom unbekannten englischen Stifter gewünscht, dem Thema Alter mit dem Schwergewicht auf Wohnen. «Wohnen ist sehr wichtig – und je älter jemand wird, umso wichtiger wird es», sagt Antonia Jann. Die Age-Stiftung will einen Beitrag leisten, den Blickwinkel weiten. Wir sind die Stiftung, die nicht selber handelt. Wir sind eine Art Treibstoff für Innovationen», betont Antonia Jann. Die Stiftung geht davon aus, dass Menschen, die im Feld arbeiten, gute Ideen haben und merken, was überhaupt möglich und nötig ist. Sie fördert dort, wo es jenen hilft, die das Projekt umsetzen, und wo man etwas aus einem Projekt lernen kann, wo es multiplizierbar ist. «Wir fördern nicht eine Standardlösung, sondern Breite und Vielfalt von möglichen Ideen», fügt sie hinzu. Die Stiftung hat seit ihrer Gründung im Jahr 2000 rund 300 Projekte gefördert und sie unterstützt jährlich Projekte mit rund drei Millionen Franken.
Wohnsituation zentral

«Die Wohnsituation hat einen grossen Einfluss auf die Lebensqualität, das Wohlergehen und die Zufriedenheit. Dies wird mit zunehmendem Alter noch wichtiger», sagt Tatjana Kistler, Medienverantwortliche von Pro Senectute.
Die Stiftung ist die grösste und bedeutendste Dienstleistungsorganisation für ältere Menschen und ihre Angehörigen in der Schweiz. Zusammen mit Raiffeisen hat sie kürzlich die Studie «Wohnen im Alter» veröffentlicht. Und diese zeigt, dass die Wohnsituation im Rentenalter viele beschäftigt. Fast zwei Drittel der 35- bis 44-Jährigen haben sich dazu bereits Gedanken gemacht. Jedoch lassen sich erst 10 Prozent beraten. Die Befragung ergab weiter, dass bei den Mieterinnen und Mietern mit zunehmendem Alter die Zufriedenheit markant zunimmt. Bei den 35- bis 44-Jährigen sind erst rund 60 Prozent mit ihrem Wohnsitz zufrieden. Dieser Wert steigt auf 90 Prozent bei Personen zwischen 65 und 75 Jahren. Doch eine gute Wohnsituation ist keine Selbstverständlichkeit. «Um bis ins hohe Alter so lange wie möglich selbstbestimmt zu leben und zu wohnen, bedarf es zusammen mit den Angehörigen einer frühzeitigen Planung und einiger Überlegungen», rät Tatjana Kistler. Pro Senectute bietet dabei Unterstützung. «Denn das aktuelle Zuhause ist nicht immer auch ideal als Wohnort im Alter geeignet.» Mit baulichen Massnahmen lassen sich zwar einige Anforderungen an ein altersgerechtes Wohnen erfüllen. Doch es gibt Grenzen. Es gibt Situationen, die einen Umzug erfordern. Dieser kann ein prägender Einschnitt sein. Gewohntes muss zurückgelassen werden. «Der Umzug in eine Alterswohnung heisst für viele dann doch, ein Stück der selbstbestimmten Lebensweise abzugeben», sagt Tatjana Kistler.
Wohnen ist mehr als vier Wände
Die Studie «Wohnen im Alter» zeigt die Bedeutung des selbstbestimmten Wohnens. Ein Grossteil der Befragten bis 75 Jahre gibt an, keine Hilfe zu benötigen. Und falls doch, seien es Familienangehörige, die unterstützen. Klar ist, dass die Förderung des selbstbestimmten Lebens an Bedeutung gewinnt. Und dabei spielen nicht nur die persönlichen Präferenzen der Direktbetroffenen eine Rolle.Unsere Gesellschaft ist förmlich dazu gezwungen, Wohnformen zu fördern, die ein weitgehend selbstbestimmtes Leben ermöglichen. Denn in den kommenden Jahren gehen die Babyboomer in Pension. Das heisst konkret: Jeder fünfte Beschäftigte in der Schweiz scheidet aus dem ersten Arbeitsmarkt aus. «Die Politik sagt ambulant vor stationär. Die Menschen sollen und wollen möglichst selbstbestimmt zu Hause bleiben», sagt Antonia Jann. Auch eine 90-Jährige soll in der eigenen Wohnung leben können. «Bekommt sie keinerlei Hilfe und Unterstützung, kann es jedoch schwierig werden», sagt sie. Infrastrukturen und Vergütungsmodelle müssen deshalb entsprechend angepasst werden. Und gerade weil der demografische Wandel gesellschaftliche Veränderungen mit sich bringt, braucht es gute Beispiele, wie die Wohnfrage im Alter angegangen werden kann. Es gibt heute bereits Angebote, die das Wohnen zu Hause unterstützen – Spitex, Mahlzeitlieferdienste oder Haushaltshilfen, wie sie Pro Senectute anbietet. Doch das Thema muss weiter gedacht werden. «Die Altersfrage muss von Anfang an bei der Arealentwicklung mitgedacht werden», sagt Antonia Jann. «Und neben den privaten Akteuren müssen auch die Gemeinden das Thema aufnehmen.» Um die Kommunen dabei zu unterstützen, hat die Age-Stiftung im laufenden Jahr die zweite Runde des Socius-Programms gestartet. Das Programm will die Datenbasis verbessern und Erkenntnisse darüber gewinnen, wie Gemeinden und Regionen möglichst gut mit der demografischen Veränderung umgehen können. Zehn Gemeinden nehmen teil. Sie bauen Unterstützungssysteme für ältere Menschen auf. Gemäss Antonia Jann nehmen Gemeinden und Regionen in der Neuorientierung der Altersvorsorge eine wichtige Rolle ein. Sie müssen schauen, dass keine grossen Angebotslücken bestehen, und sie sollten dafür sorgen, dass zivilgesellschaftliches Engagement gefördert und sorgfältig gepflegt werden kann.

Alt ist nicht gleich alt
In der Diskussion um neue Wohnformen zeigt sich ein spannendes Phänomen in der Bezeichnung. «Generationenwohnen ist ein Zauberbegriff», sagt Antonia Jann. «Niemand hat etwas dagegen.» Für die Älteren ist der Begriff positiv, weil sie sehr gerne mit jüngeren Leuten zusammen sind. Umgekehrt stört es diese nicht, wenn es auch Ältere hat. Schwierig wird es mit dem Begriff «alt». Heute deckt der Begriff eine Zeitspanne von praktisch 40 Jahren ab. 60-jährige Arbeitnehmende wie auch 100 Jahre alte Rentnerinnen können damit gemeint sein. Deswegen gibt es eigentlich kein Alter, sondern ein Älterwerden. Antonia Jann ist denn auch der Meinung, dass ein einziges Wort wie «alt» nicht ausreicht. Als Vergleich zieht sie den Schnee heran. In Afrika mag es genügen, ein Wort für Schnee zu nutzen. In Grönland dagegen braucht es eine Vielzahl. Deswegen auch die Skepsis gegenüber dem Wort «alt». «Sagen die Leute, ich bin noch nicht alt, heisst das, ich bin noch nicht gebrechlich, ich kann noch für mich selber sorgen. Ich kann meinen Alltag gestalten», sagt Antonia Jann. «Das heisst aber nicht, dass diese Personen meinen, sie seien noch jung. Vielmehr bringen sie zum Ausdruck, dass sie noch gewillt sind, selbständig zu sein.»
Gesunde Jahre verlängern
Damit dies gelingt, braucht es die eigene Gesundheit. Doch die zusätzlichen Jahre, welche die steigende Lebenserwartung bringt, erleben die Menschen nicht automatisch bei bester Gesundheit. Krankheiten können das selbstbestimmte Leben jäh beenden. Um diese Gefahr zu mindern und die gesunden Lebensjahre zu verlängern, forscht die ETH Zürich im Bereich Healthy Aging. Zusätzliche Lebensjahre sollen möglichst von chronischen Krankheiten entkoppelt werden. Neben der bestehenden Forschungsarbeit zahlreicher Professorinnen und Professoren der ETH Zürich mit vielfältigen Bezügen zum Thema wurde eine zusätzliche Professur für dieses Thema geschaffen. Seit Anfang 2020 ist James Mitchell Professor für Biologie des gesunden Alterns. Zuvor war er ausserordentlicher Professor an der Harvard School of Public Health in Boston. Er beschäftigt sich mit spezifischen Aspekten der biologischen Alterung und mit wissenschaftlich fundierten Ansätzen der Beeinflussung dieses Prozesses sowie damit einhergehenden Erkrankungen. Die Grenzen zwischen der Medizin und seiner Forschung sind fliessend: Er erforscht die molekularen Mechanismen, welche die Entwicklung altersbedingter Krankheiten verzögern und uns länger gesund halten.

«Durch die Unterstützung von Gönnerinnen und Gönnern sowie Partnern wird Forschung für unsere Gesundheit und für gesundes Altern beschleunigt», sagt Donald Tillman, Geschäftsführer der ETH Foundation.
Mehr als Pflege
Auch die Paul Schiller Stiftung engagiert sich in der Forschung, allerdings in einem Bereich, der im Kontext zu ihren Förderkriterien steht. Der Fokus ihrer Arbeit im Förderbereich Alter liegt aktuell stärker auf den soziokulturellen und psychosozialen Faktoren. Deren Bedeutung lässt sich beispielsweise vom Tagesablauf eines älteren Menschen ableiten: «So entscheidend die pflegerische und die medizinische Betreuung sind, sie nehmen nur einen sehr kleinen Zeitabschnitt im Tagesverlauf ein», hält Maja Nagel Dettling fest. So sind es in der Regel auch diese Leistungen, die als Erstes sichergestellt und finanziert sind. Doch für die Lebensqualität älterer Menschen, gerade bei eingeschränkter Selbständigkeit, ist die restliche Alltagsgestaltung die grosse Herausforderung. «Hier ist definitorische Arbeit wichtig und die Wissenschaft gefordert. «Es gilt, den Austausch mit der gesamten Gesellschaft und der Fachwelt zu fördern», sagt sie. Gerade im Zeichen des Coronavirus werde realisiert, dass neben der Pflege auch psychologische und soziale Betreuung gefragt sind. Dazu braucht es die entsprechenden Kompetenzen, bspw. sozialpädagogisches Fachwissen oder Fachwissen, wie es die Fachangestellten in der Betreuung oder die Aktivierungsfachfrauen mitbringen. Hier will die Stiftung wirken. «Es gilt, den häufigsten Leiden im Alter entgegenzuwirken», sagt Maja Nagel und sie zählt – basierend auf der Eden-Philosophie – die Einsamkeit, die Nutzlosigkeit und die Langeweile dazu. In der Stärkung dieser ganzheitlichen Sichtweise auf das Alter sieht sie grosses Potenzial. Hier können Stiftungen viel bewirken. Vernetzung und Koordination verstärken den Dialog, dessen ist sich Maja Nagel Dettling bewusst. «Wir brauchen Fakten. Wir müssen wissen, was die Herausforderungen sind», sagt sie. Deswegen engagiert sie sich auch im Arbeitskreis Alter von SwissFoundations, in dem sich verschiedene Stiftungen über die grossen Herausforderungen austauschen und dazu abstimmen. Für Maja Nagel Dettling ist ein ganzheitliches Verständnis vom Menschen und damit auch vom Alter wichtig. Es gehe nicht nur um gesund oder krank, genauso entscheidend sind die Umfeldfaktoren, eine sinngebende Alltagsgestaltung und soziale Kontakte.
Gegen die Einsamkeit können einfache Dinge wie ein Lachen helfen oder ein unbeschwerter Austausch mit Kindern. «Die ersten Aktivitäten mit sogenannten Begegnungsclowns fanden in Altersheimen in den 90er Jahren statt», sagt Beat Hänni. Oft hätten jedoch die finanziellen Mittel gefehlt. Die 2005 gegründete Stiftung für
Humor & Gesundheit ermöglichte seither mit Teil- und Anschubfinanzierung rund 70 solcher Projekte. Dazu gehören auch Projekte wie die Besuche mit Kindergartenklassen in einem Heim für Demente. Die Kinder schaffen es, mit ihrer Unbeschwertheit eine heitere Brücke zu schlagen. Die Stiftung für Humor & Gesundheit engagiert sich neben Begegnungsclowns auch für Humorschulungen in Alters- und Pflegeheimen als Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitenden. Dies erleichtert den Umgang mit den Bewohnerinnen und Bewohnern und mobilisiert den eigenen Humor als Ressource zur Bewältigung schwieriger Situationen. Denn Humor kennt kein Alter!
Coronakrise
Ein direkter persönlicher Austausch ist in der aktuellen Krise schwieriger geworden. Gleichzeitig zeigt sich gerade jetzt, welche Macht diese zwischenmenschlichen Aspekte haben. Aufgrund des Coronavirus sind ältere Menschen isoliert, verbleiben grösstenteils in ihren Wohnungen oder Heimen. Es gibt aber auch viel soziales Engagement, viel Positives. Der Wert der Betreuung wird sichtbarer. Viele Initiativen nehmen sich der älteren Menschen an. Oft steht vordergründig eine einfache Dienstleistung wie das Einkaufen auf dem Programm. Von Bedeutung ist jedoch der dazugehörige soziale Aspekt. «Dank dieser Kontakte haben die Menschen doch noch einen Zugang zur Gesellschaft – trotz der Isolation», sagt Maja Nagel Dettling. Viele Stiftungen haben in der Krise ihre Kompetenzen genutzt und vielfältig und schnell reagiert: Pro Senectute bspw. hat mit der Migros einen Einkaufs- und kostenlosen Lieferservice ausschliesslich mit Freiwilligen für Menschen in Quarantäne lanciert und in Kürze fast 30’000 registrierte Helferinnen und Helfer gefunden. In der Krise wurde offensichtlich, was meist im Hintergrund verborgen bleibt: die Bedeutung und das Potenzial der freiwilligen Helferinnen und Helfer – eine unterschätzte Arbeit. «Eigentlich sind wir eine grosse Branche: Jeder Dritte leistet Freiwilligenarbeit. Insgesamt leisten sie rund 660 Millionen Arbeitsstunden im Wert von 34 Milliarden Franken pro Jahr», sagt Thomas Hauser, Geschäftsleiter von Benevol, der Dachorganisation für Freiwilligenarbeit in der Schweiz.
Helfen ist schwierig, Hilfe annehmen schwieriger
Freiwilligenarbeit ist aus unserer Gesellschaft nicht wegzudenken. Praktisch jeder Lebensbereich wird von ihr geprägt. Doch sie muss sich der Schwierigkeit stellen, sich als Branche Beachtung zu verschaffen: «Im Kleinen ist sie oft von grossem Stellenwert, im Grossen aber von kleinem», sagt Thomas Hauser. Die kleinen, lokalen Projekte sind oft von stillen Schafferinnen und Schaffern getragen. Diese Nähe zu den Menschen, das Eingebundensein in lokale, individuelle Projekte verhindert, dass die gesamtgesellschaftliche Leistung gebührend wahrgenommen wird. «Freiwilligenarbeit erfährt aus Bundesbern keine Förderung und ist gesetzlich nicht geregelt», sagt Thomas Hauser. Auch wenn er sich bessere Rahmenbedingungen wünscht, bspw. in Form zur Verfügung gestellter Lokalitäten würde er eine Regulierung als kontraproduktiv erachten. Denn Freiwilligenarbeit kann nicht erzwungen werden. «Es braucht die persönliche Betroffenheit. Dann sind die entsprechenden Ressourcen schnell vorhanden», sagt er. Die Freiwilligenarbeit kommt aus der Zivilgesellschaft. Und hier spielt die ältere Generation einen wichtigen Part. Die aktuelle Krise zeigt ihre Doppelrolle. Sie sind Leistungserbringer und ebenso Leistungsempfänger. Dass viele ältere Menschen jetzt aufgrund von Corona in der Freiwilligenarbeit fehlen, ist spürbar. Die jüngere Generation ist gefordert und zeigt sich sehr engagiert bezüglich Versorgungshilfen für die Risikogruppen. Der Krisenalltag zeigt, dass das Wechselspiel zwischen Helfen und Hilfe annehmen gelernt werden muss und kann. «Helfen ist schwierig», sagt Thomas Hauser, «Hilfe annehmen manchmal noch schwieriger.» Wer die Erfahrung gemacht hat, als Freiwilliger zu helfen, dem wird es leichter fallen, Hilfe anzunehmen. Gerade bei der älteren Generation ist das entscheidend. Thomas Hauser spricht denn auch von einer dritten und vierten Generation, einer aktiven dritten und einer vierten, die auf Unterstützung angewiesen ist. «Im Austausch kann man sich besser vorstellen, was einen im letzten Lebensabschnitt erwartet und wie man den gestalten möchte», sagt er. Um die dritte Generation zu Freiwilligenarbeit zu motivieren, braucht es vor allem attraktive Angebote. «Moderne Freiwilligenarbeit geht nicht ohne Partizipation: Sinnhaftigkeit entsteht, wenn das Individuum das Gefühl hat, den Unterschied zu machen. Freiwillige wollen mitprägen, mitbestimmen.» Dabei hat sich in den vergangenen Jahren eine grundlegende Veränderung ergeben. Freiwillige engagieren sich heute viel lieber projektbezogen, als sich für eine längere Zeit zu verpflichten – auch wenn das Engagement am Ende von Projekt zu Projekt über Jahre gehen kann. Die Individualisierung in der Freiwilligenarbeit hat auch etwas Paradoxes. Thomas Hauser hält fest: «Die Sinngebung ist erst im Kollektiv erlebbar.»


