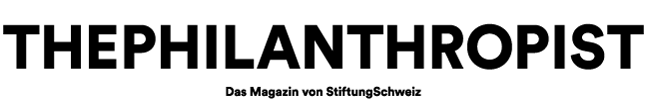Der Präsident des Stiftungsrats der Ernst Göhner Stiftung Beat Walti sieht die liberale Ordnung als Garant für einen vielfältigen Stiftungssektor. Der Rechtsanwalt und FDP-Nationalrat bewertet die freien Mittel der Stiftungen als wertvolle Ergänzung zur staatlichen Förderung.
Sie engagieren sich in unterschiedlichen Stiftungen. Was fasziniert Sie an diesem Sektor?
Neudeutsch würde man von Diversity sprechen: Dieser Sektor ist derart vielfältig und von den unterschiedlichsten Zielsetzungen geprägt. Stifterinnen und Stifter haben diese im jeweiligen Stiftungszweck aus Überzeugung und mit grossem Engagement formuliert. Was mich besonders fasziniert ist das starke persönliche Commitment, das hinter jeder Stiftung spürbar ist.
Sie sind Stiftungsratspräsident der Ernst Göhner Stiftung. Diese ist hochprofessionell aufgestellt. Spüren Sie den Stifter überhaupt noch?
Ja, durchaus. Der Stifter ist omnipräsent. Bei der Ernst Göhner Stiftung decken wir ein breites Spektrum ab. Wir sind eine Unternehmerstiftung, eine philanthropische Stiftung und eine Familienstiftung. Diese Zwecke dienen als Richtschnur für den Stiftungsrat.
Wie zeigt sich dies?
Wie eine Kapitalgesellschaft führen wir periodisch eine Strategiediskussion. Dabei ist völlig klar, dass wir uns daran orientieren, was der Stifter wollte. Seine Idee in die Aktualität zu übertragen, ist die Vorgabe. Ernst Göhner selbst hatte ein eindrückliches Lebenswerk geschaffen. Diesem unternehmerischen Erbe sind wir verpflichtet. Ernst Göhner war ein sehr innovativer Typ. Er hat gleichermassen Strukturen aufgebrochen und sich für den Werk- und Arbeitsplatz Schweiz eingesetzt. Diesen Gedanken wollen wir pflegen. Und dasselbe Engagement gilt für den philanthropischen Bereich.
Wie kamen Sie überhaupt in den Stiftungssektor?
Mein erster Kontakt zur Stiftungswelt erfolgte recht klassisch im gemeinnützigen Bereich.
Das heisst?
Als Kantonsrat in Zürich wurde ich vor ungefähr 20 Jahren vom Züriwerk angefragt, ob ich im Stiftungsrat mitwirken würde. Die Stiftung engagiert sich für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung. Gemeinnützige Organisationen im sozialen Bereich sind in der Regel bei der Finanzierung von der öffentlichen Hand abhängig. Mit der Verbindung zur Politik in ihren Gremien fällt es ihnen leichter, ihren Anliegen Gehör zu verschaffen. Das war mein erster Approach. Auch beruflich gab es Berührungspunkte. Als Anwalt habe ich auch Stiftungen gegründet und beraten.
Nicht nur die Gründung ist ein administrativer Aufwand. Gefährden zunehmende Anforderungen die Vielfalt des Sektors?
Ja, es ist ein Trend, den es sorgfältig zu beobachten gilt. Allgemein steigen
die Erwartungen bezüglich Dokumentation und regulatorischen Vorgaben. Dabei wird relativ selten zwischen ganz kleinen und ganz grossen Stiftungen unterschieden. Und der Trend ist, dass sich die Vorgaben an den komplexeren Stiftungen orientieren.
Macht diese Regulierung Sinn?
Der Stiftungsstandort Schweiz war in den letzten Jahrzehnten so erfolgreich, weil er freiheitlich reguliert war. Gerade für die Motivation gilt es, diese liberale Grundordnung beizubehalten. Sie erlaubt die Realisierung der allerverschiedensten Ideen. Es ist ein legitimer Anspruch derjenigen, die Teile ihres privaten Vermögens in eine Stiftung geben, dass sie nicht noch eine Flut von Vorgaben berücksichtigen müssen. Juristisch handelt es sich immer um ein definitiv verselbständigtes Sondervermögen mit eigenem Zweck. Die Stifterin oder der Stifter lässt das Stiftungskapital los.
Und welche Rolle kommt der Aufsicht zu?
Eine zweckmässige, zielgerichtete und wirksame Aufsicht im Stiftungssektor ist richtig, weil die Eigentümerkontrolle fehlt. Eine Kapitalgesellschaft hat Eigentümer, welche ihren Besitz schützen und die Geschäfte prüfen. Diese Kontrollebene fehlt bei Stiftungen. Die Stiftungsaufsicht ersetzt diese Prüfung. Sie kann und soll sicherstellen, dass die Stiftungsmittel nicht zweckentfremdet werden.
Was bedeutet dies für kleine Stiftungen?
Es gibt kleine Stiftungen, die mit einem bescheidenen Kapital wirtschaften. Sie haben häufig einen sehr spezifischen Zweck sowie überschaubare Vergaben und Verwaltungsstrukturen. Da ist die Frage berechtigt, wie umfassend die Dokumentation zur Rechenschaftsablage sein muss. Natürlich muss am Ende gewährleistet sein, dass die Mittel zweckgemäss eingesetzt wurden. Dass die Stiftungsaufsicht eine Jahresrechnung sehen will, ist richtig. Aber alles Weitere, was letztlich v.a. die Aufsichtsgebühren in die Höhe treibt, sollte für solche Stiftungen hinterfragt werden. Wünschbar wären administrative Erleichterungen für Stiftungen, die gewisse Kenngrössen nicht übertreffen.
Braucht es die kleinen Stiftungen überhaupt?
Unbedingt. Man sollte nicht gleichgültig mit den Schultern zucken und sagen: Dann sollen die kleinen Stiftungen sich halt zusammenschliessen. Eine kleine Struktur mit einer guten Idee kann in der Praxis sehr Wertvolles bewirken. An regulatorischen Rahmenbedingungen darf dies nicht scheitern. Natürlich gibt es eine sinnvolle Mindestgrösse. Und kleine Stiftungen können den Aufwand eingrenzen, indem sie sich bei den Projekten auf einen Bereich fokussieren, in dem sich der Stiftungsrat auskennt und die Stiftung Expertise besitzt oder entwickelt.
Gefährdet dies nicht Kleinstprojekte?
Bei der Ernst Göhner Stiftung verfolgen wir die Philosophie, explizit auch kleine Projekte zu unterstützen. Da können immer wieder Beträge von weniger als 5000 Franken gesprochen werden. Wir machen dies, weil wir gerade auch im kulturellen Bereich viele kleine Projekte sehen, bei denen sehr viel Dynamik entsteht. Das ist wertvoll. Das wollen wir fördern.
Arbeiten Sie auch mit anderen Stiftungen zusammen?
Ja. Einerseits hat die Ernst Göhner Stiftung eine Wegbereiter-Rolle. Wir haben eine professionelle Organisation. Mitarbeitende mit grosser Erfahrung prüfen die Gesuche. Sie können die Projekte kompetent einschätzen. Diese Einschätzung kann auch für andere Stiftungen hilfreich sein. Andererseits arbeiten wir etwa im Bereich Start-up- und Innovationsförderung systematisch mit der Gebert Rüf Stiftung zusammen. Mit dem Projekt «Venture Kick» fördern wir gemeinsam, seit mehr als zehn Jahren, Start-up-Projekte aus dem Hochschulumfeld über mehrere Etappen. Diese Start-ups haben schon Tausende von Arbeitsplätzen geschaffen. Hier ist volkswirtschaftlich etwas Wertvolles entstanden. Das war nur möglich, weil zwei Stiftungen mit den notwendigen Mitteln substantiell über längere Zeit investieren. Im Kulturbereich kooperieren wir bspw. mit der Kiefer Hablitzel Stiftung, und bei der Talentförderung mit der Schweizerischen Studienstiftung durch Stipendienprogramme.
Was ist der Vorteil einer Zusammenarbeit?
Viele Stiftungen haben, gewollt durch den Stifter, einen engen Fokus. Dadurch haben sie ein sehr spezifisches Know-how. Wenn dieses Wissen kombiniert wird – und auch noch die finanzielle Basis verbreitert –, ergeben sich sehr sinnvolle Kooperationen.
Könnte der Staat die Aufgabe von Stiftungen nicht einfach übernehmen?
Die Stärke ist das Zusammenwirken. Es würde zu weit gehen, wenn im Kulturbereich – wie auch im Sozialbereich – alles, was sich kommerziell nicht verwirklichen liesse, abhängig von privaten Initiativen und Überzeugungen wäre. Diese Zeiten haben wir zum Glück hinter uns. Umgekehrt gibt es Bereiche, in denen die Herausforderungen sehr viel vielfältiger sind, als dass ein Gesetz oder eine Administration diese erfassen und berücksichtigen könnte. Es ist ungemein wertvoll, für diese Ideen frei disponierbare Mittel zu haben. Stiftungen können wichtige Impulse setzen, die sich dann in Strukturen entwickeln, in denen sich auch die öffentliche Hand engagiert. Dieses Abgleichen muss ein permanenter Prozess sein. Gebe es nur einen staatlich unterstützten Kulturbereich, könnte eine Hochschule der Künste mit ihrer Philosophie weitgehend alleine die Richtung bestimmen. Wenn es aber noch einen Bereich gibt mit frei verfügbaren Mitteln, kann etwas anderes entstehen, welches das Etablierte herausfordert. Das bringt mehr Dynamik und Entwicklung. Öffentliche Hand und Stiftungen ermöglichen zudem viele Projekte gemeinsam. Es ist weniger ein Interessengegensatz, sondern eine sinnvolle Kombination.
Weil diese Gelder steuerbefreit sind, wird zum Teil mehr Transparenz gefordert. Muss sich die Stiftungswelt besser erklären?
Die Steuerbehörde macht klare Vorgaben, was erfüllt sein muss, damit eine Organisation – dies gilt nicht nur für Stiftungen – steuerbefreit ist. Die Liste der steuerbefreiten Organisationen ist öffentlich. Diese Transparenz gibt es bereits. Wenn Transparenz aber bedeutet, dass der Einsatz des letzten Frankens öffentlich sein muss, geht das zu weit. Oft ist dies auch gar nicht im Interesse des Empfängers. Stiftungen wirken auch in Bereichen, in denen es Diskretion braucht. Die Stiftungen wissen aber auch, dass eine zweckdienliche Information über ihr Wirken für die Zielerreichung häufig nützlich oder gar nötig ist.
Könnten Stiftungen dieser Forderung
entgegenwirken?
Die Kommunikation wird zukünftig wichtiger. Der Stiftungssektor muss sich erklären und aufzeigen, dass er keine Blackbox ist. Oft findet der Stiftungssektor in der Öffentlichkeit nur Aufmerksamkeit, wenn kontrovers über eine Spende diskutiert wird. Diese Diskussion fällt dann auf unbestellten Boden. Wir müssen aufzeigen, was in diesem Sektor geleistet wird, was dahintersteckt. Kommunikation wird wichtig sein, damit die Stiftungswelt fit bleibt.