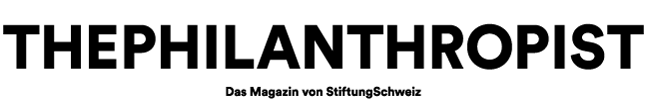Zum Zeitpunkt der Gründung der Embolo Foundation stand Breel Embolo mit 17 Jahren am Anfang seiner Fussballkarriere. Dank eines gut eingespielten Teams kann die Stiftung heute schnell reagieren und zielgerichtet helfen.
2015 haben Sie Ihre eigene Stiftung gegründet. Was war der Auslöser?
Breel Embolo: 2015 war ich noch in der Lehre beim Fussballverband. Meine Lehrmeisterin war Jeannette Paolucci. Sie hatte die Idee, eine Stiftung zu gründen.
Weshalb eine eigene Stiftung? Um Gutes zu tun, hätten Sie auch einfach spenden können?
Meine Familie unterstützte bereits damals ein Patenkind mit Geld. Und Jeannette Paolucci war selbst gemeinnützig engagiert in Peru. Bei einem spontanen Gedankenaustausch stellten wir fest, dass wir mit dem gemeinnützigen Engagement ein gemeinsames Interesse haben. Daraus ist die Idee entstanden, dass wir mit meinem Namen noch mehr bewegen könnten. Zugegeben, ich war zu Beginn ein wenig skeptisch. Damals war ich erst 17 Jahre alt. In diesem Alter eine Stiftung in meinem Namen zu gründen, war für mich eine Herausforderung. Was ändert sich jetzt für mich, habe ich mich gefragt.
Sie standen noch am Anfang Ihrer Fussballerkarriere und spielten noch beim FCB.
Ich war noch sehr jung. Ich war auch noch nicht Nationalspieler. Eigentlich war ich noch nicht einmal richtig Stammspieler beim FCB und hatte noch nicht den Ruf und das Image, das ich heute habe.
Hat die Stiftungsgründung mit dem eigenen Namen nicht viel Mut gebraucht?
Doch, es hat mir sehr viel Mut abverlangt. Es hat in der Öffentlichkeit Erwartungen geweckt. Ich konnte es nicht gleich wie Jeannette Paolucci abschätzen. Selber hätte ich mich das nicht getraut. Aber sie hat an mich geglaubt. Sie hat realisiert, wie viele Menschen wir mit meinem Namen bewegen können, was wir erreichen und wie wir damit Kindern helfen können. Heute muss ich sagen, die Gründung der Stiftung war die beste Idee. Die ersten Jahre haben mir vor allem die Augen geöffnet und gezeigt, was wir alles bewegen können. Den Menschen unkompliziert zu helfen, ist sehr schön. Bisher läuft alles gut. Aber natürlich kann es immer noch besser laufen.
Wo ist die Stiftung tätig?
Wir realisieren Projekte in Kamerun, wo ich herkomme, und in Peru, wo Jeannette Paolucci bereits zuvor engagiert war. Sie ist im Stiftungsrat. Und wir engagieren uns in der Schweiz.
Wer über die Arbeit der Stiftung liest, erhält den Eindruck, dass bei Ihnen das Machen im Vordergrund steht.
Das ist korrekt. Wir wollten etwas Familiäres aufbauen, etwas anderes. Wir wollen allen, die etwas spenden, das Gefühl geben, dass jeder Rappen hilft. Egal, ob jemand fünf Rappen oder 5000 Franken spendet, es ist wichtig. Wir sind nicht mit Geld gesegnet. Darum kämpfen wir um jeden Rappen. Wir sind sehr froh um jede Spende. Und wir wollen zeigen, wo jeder Rappen hingeht.
Haben Sie die Projekte selbst besucht?
Projekte in der Schweiz und in Kamerun habe ich selbst besucht oder ich war bei Anlässen dabei. In Peru war ich leider noch nicht. In meiner Ferienzeit bin ich immer ein paar Tage karitativ unterwegs. Dann besuche ich die Projekte selbst. Es ist ein sehr schönes Erlebnis zu sehen, wo die Hilfe ankommt und wie sich die Menschen selber helfen.
Was nehmen Sie von diesen Begegnungen mit?
Sie geben mir Kraft. Und ich kann abschalten. Es ist wirklich etwas ganz anderes. Das soll es auch sein. Das war unser grosses Ziel. Wir alle haben schon für ein Projekt gespendet. Aber wenn man einen direkten Draht zu einem Projekt hat, es besucht und erleben darf, was geleistet wird, und realisiert, wie wir helfen können, dann berührt das. Es macht Lust, noch mehr zu helfen. Ich habe gesehen, was die Menschen brauchen. Und wir alle spüren eine ungemeine Dankbarkeit. Die Menschen freuen sich. Erstens zu sehen, dass die Hilfe funktioniert, und zweitens zu erkennen, dass sie bei den Empfängern dringend notwendig ist, sind die beiden Punkte, die wir mit unserer Stiftungsgründung anvisiert haben.

«Wir wollen zeigen, wo jeder Rappen hingeht.»
Breel Embolo
Sie realisieren beispielsweise einen Fussballplatz in Peru. Wie entstehen solche Projekte?
Das ist ganz unterschiedlich. Wir haben einen guten Draht zum Fussballverband. Und durch unsere vielen Kontakte erhalten wir viele Anfragen. Wir haben auch schon gemeinsam mit einem Partner eine Schule gebaut und die Mittel dazu zusammen organisiert. Bei den unterstützten Projekten ist es uns wichtig, diesen Menschen eine Perspektive zu geben. Deswegen engagieren wir uns für Bildung, aber auch für gesunde Ernährung und für die Gesundheit. Dieses Projekt hat gut geklappt. Generell haben wir immer verschiedene Projekte am Laufen, auch kleinere. Und wir realisieren Hilfe auch kurzfristig, wie jetzt für die Ukraine.
Was haben Sie gemacht?
Wir haben Hilfsgüter organisiert und sind an die Grenze gefahren – Jeannette Paolucci ist auch selbst mitgefahren. Auf dem Rückweg haben wir Flüchtlinge mitgenommen.
Um so schnell zu reagieren, braucht es ein gut eingespieltes Team.
Das sind wir definitiv. Wir sind ein Team, eine Familie. Aufgrund meiner Aufgaben als Profifussballer bei Borussia Mönchengladbach kann ich nicht an jeder Sitzung dabei sein. Aber ich werde immer über alles informiert. Ich weiss, was läuft. So können wir immer flexibel reagieren.
Wie auf den Krieg in der Ukraine?
Vor einem Jahr hätte noch niemand gedacht, dass es in einem europäischen Land wieder Krieg gibt. Wir haben uns einfach zusammengesetzt und besprochen, was wir machen können. Das können ganz einfache Fragen sein wie, was das Benzin hin und zurück kostet. Wir überlegen, ob wir das Budget für das Projekt haben. Wenn wir uns entscheiden, ein Projekt zu realisieren, dann geht das relativ schnell. Wir haben ein Team, das extrem flexibel und fleissig ist. Es ist mit ganzem Herzen und mit fester Überzeugung dabei. Dabei verfolgen sie 0,0 Prozent eigene Interessen. Es ist uns allen wichtig, dass diese Projekte nicht aus Imagegründen realisiert werden. Jeder hilft aus Überzeugung. Dies zu erleben, gibt mir immer wieder Gänsehaut. Da funktionieren wir wirklich wie eine Familie.


Das Integrationsturnier war das erste Projekt in der Schweiz. 2017 fand die zweite Ausgabe in
Reinach BL statt
Auch nach der Flutkatastrophe im deutschen Ahrtal im vergangenen Jahr hat die Stiftung schnell geholfen. Ihre Projekte zeichnen sich dadurch aus, dass Sie auf ein breites Netzwerk, gerade aus dem Fussball, zurückgreifen können. Macht das Gemeinsame aus Ihrer Sicht die gemeinnützige Arbeit aus?
Ja. In solchen Situationen kann jeder sehen, was passiert, und sich in die Lage der Betroffenen versetzen. Über das Internet und die sozialen Medien ist es dann einfach, Menschen zu kontaktieren und zu mobilisieren.
Wie sah die Aktion aus?
Das Schöne war, dass die Aktion im Ahrtal mit Fussball zu tun hatte. Wir wurden auf die Hilfsaktion «Fussball hilft Fussball» eines Fussballers aus Ahrweiler aufmerksam und haben uns entschieden, zu helfen. Jeannette Paolucci hat über die sozialen Medien zu Sachspenden aufgerufen, und zahlreiche Fussballclubs, Unternehmen, aber auch anonyme Spenderinnen und Spender haben sich beteiligt. So konnten wir auch hier schnell und flexibel reagieren. Dabei hilft es, dass wir unsere Stiftung nicht auf ein Projekt festgelegt haben und wir jederzeit helfen können. Wir können Projekte in der Stiftung besprechen, Einwände diskutieren und klären, ob wir die Mittel haben und wie wir helfen können. Oder ob wir uns besser in einem anderen Projekt engagieren. Und dann setzen wir dies um – und schauen wieder nach vorne. Leider passieren zu viele Dinge, als dass wir immer helfen könnten. Wir funktionieren familiär, wir stehen zusammen und bereiten uns vor, damit wir reagieren können.
Haben Sie ein Projekt, das Ihnen speziell am Herzen liegt?
Ich wollte die Projekte der Stiftung immer mit Fussball verbinden. Deswegen bin ich besonders stolz auf unser Flüchtlings-Fussballturnier, unser erstes Projekt in der Schweiz. Wir wollten den Flüchtlingen das Gefühl geben, dass sie willkommen sind. So ist die Idee entstanden, ein Integrationsturnier zu organisieren. Wir wollten den Flüchtlingen einen Tag schenken. Sie sollten für diesen Tag nur den Sport geniessen und Spass haben. Es war sehr speziell, als ich beim ersten Turnier dabei sein konnte. Ehemalige Mitspieler, Fussballspieler und andere Prominente waren auch dabei. Das Turnier hat gezeigt, welche Kraft der Sport hat, wie er alle verbindet.
Wie stark spielt Ihre eigene Geschichte eine Rolle?
Auch mir hat der Sport stark geholfen, mich zu integrieren, als ich aus Kamerun in die Schweiz kam. Das ist der Hintergrund, weshalb das Turnier für mich so speziell ist. Es ist uns gelungen, den Flüchtlingen einen Tag zu bieten, an welchem sie ihre Probleme auf die Seite legen können. Zehn, zwölf Stunden konnten sie unbeschwert Fussball spielen. Aber wir sind uns auch bewusst, dass ihr Leben nach diesem Tag weitergeht.
Als Sie Ihre Fussballlaufbahn beim FC Nordstern in Basel angefangen haben, hatten Sie bereits das Ziel Fussballprofi im Kopf?
Ich sage immer, Fussball ist ein Traumberuf, weil du erlebst, wie viele Kulturen, wie viele Menschen mit unterschiedlichsten Sprachen sich treffen und kein Problem miteinander haben. Wenn man all die Menschen im Stadion erlebt, dann kann man gut verstehen, weshalb Sport diese Vorbildfunktion hat, um Menschen zu verbinden und zusammenzubringen. Das Ziel auf dem Platz ist ja relativ einfach: Der Ball muss ins Tor. Deswegen ist das Spiel für mich auch der einfachste Weg zur Integration. Als ich beim FC Nordstern angefangen habe, war ich nicht das Riesentalent, das locker zehn Gegenspieler ausgespielt hat. Fussball war für mich vielmehr Integration. Ich habe in der Schule Fussball gespielt, ich hatte schon in Kamerun Fussball gespielt, ich habe in Basel in meinem Wohnquartier Fussball gespielt. So habe ich Menschen kennengelernt und Emotionen erlebt. Natürlich haben wir auch gestritten. Aber das war am nächsten Tag wieder vergessen.
Und wie sind Sie beim FC Nordstern gelandet?
Ich ging zum FC Nordstern, weil die meisten meiner Kollegen aus dem Quartier dort spielten. An eine Profikarriere hatte ich nie gedacht. Der Fussball war damals einfach der beste Teil meines Lebens. Ich konnte so sein, wie ich wollte. Ich durfte mit meinen Kollegen Fussball spielen. Das Schönste war, wenn wir am Sonntag gemeinsam auf dem Platz standen. Und wenn wir gewonnen haben, war das am Montag Gesprächsthema Nummer eins.
Mit Manuel Akanji haben Sie einen Kollegen aus der Nationalmannschaft als Botschafter für die Stiftung gewonnen. War es schwierig, ihn von dieser Rolle zu überzeugen?
Nein. Es war toll, dass er sofort mitgemacht hat. Manuel ist unterdessen wie ein Bruder für mich. Wir sind ständig in Kontakt. Wir wissen alles voneinander. Auch er engagiert sich stark für Projekte in Nigeria. Da werde ich ihn auch unterstützen. Deswegen war es relativ einfach, ihn zu begeistern. Er kennt alle Leute hier. Insbesondere Jeannette Paolucci kennt er sehr gut.
Welche Projekte wollen Sie in Zukunft in Angriff nehmen?
In Bezug auf die Stiftung möchten wir das Konzept etwas ändern. Wir wollen verschiedene Anlässe veranstalten und mehr nach aussen treten. Wir wollen das Team verjüngen und die Arbeit für sie einfacher machen. Das ist mein grösstes Ziel: jenen Menschen, die schon so viel für die Kinder machen, das Leben zu vereinfachen. Wir haben ganz viele Unterstützerinnen und Unterstützer, die schon älter sind. Sie arbeiten mit viel Herzblut. Aber sie nehmen sehr viel auf sich. Deswegen wollen wir sie entlasten und auch jüngere Helferinnen und Helfer ansprechen, sie motivieren, sich zu engagieren. Es ist mein Anliegen, mit der Stiftung noch wichtigere Projekte zu realisieren. Das wäre eine riesige Ehre für mich, neben dem Sport. Nun müssen wir die verschiedenen Ideen in der Stiftung zusammenbringen. Wir sind auf gutem Weg. Und hoffentlich gelingt es irgendwann, meinen grössten Traum zu realisieren.
Was wäre Ihr grösster Traum?
Ich möchte eine Fussballakademie gründen. Dort könnten wir Kinder aufnehmen, ihnen mit Sport und Bildung eine Zukunft ermöglichen. Dann könnte ich mich mit 35 oder 40 Jahren neben dem Platz für die Kinder engagieren und von meiner Erfahrung etwas weitergeben. Das ist mein grösster Traum.