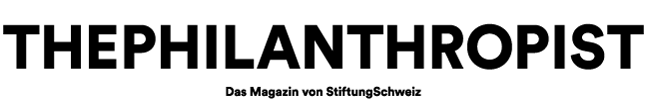The Philanthropist: Was sind die grossen Herausforderungen, die sich Ihrer Stiftung heute stellen?
Marco Beng: Alle Betriebe haben Leistungsaufträge der öffentlichen Hand. Bei grösseren Projekten, wie zum Beispiel Bauprojekten bleiben immer grössere Kosten übrig, welche nicht vom Kanton oder Bund übernommen werden und welche die Stiftung ausfinanzieren muss. Daher mussten wir in das Fundraising investieren, um hier grössere Blöcke mittels Stiftungsfundraising finanziert zu erhalten. So wurde der Neubau für die Gärtnerei in der Höhe von 2,5 Millionen Franken zur Hälfte durch Beiträge des kantonalen Sozialamts sowie der Rest durch die Schweizerische Epilepsie-Stiftung selber finanziert. Er war letztlich aber nur dank über 600 kleineren bis grösseren Spenden realisierbar. Wir und v.a. unsere 28 Mitarbeitenden in den geschützten Arbeitsstellen in der Gärtnerei sind sehr dankbar dafür, dass wir einen Bau aus den 60er Jahren, der überhaupt nicht mehr dem modernen Arbeiten entsprach, ersetzen konnten.
TP: Ihre Stiftung wurde 1886 gegründet. Was war der Auslöser?
MB: Damals gab es eine Bewegung über ganz Europa, dass man für Kinder mit Epilepsie ein Zentrum pro Land schafft, in dem die Kinder mit ihrer Krankheit betreut, geschult und erzogen wurden und dort ein zu Hause hatten. Bis dahin waren die Kinder oft in Psychiatrien untergebracht, was sicher nicht optimal war. In der Schweiz haben kirchliche und schulische Kreise das Geld zusammengebracht, um das weitläufige Areal – damals weit ab vom Zentrum von Zürich und der Nähe der Psychiatrischen Universitätsklinik (PUK) – zu kaufen. Das älteste Zentrum, das ich kenne ist in Valence, Frankreich, und ist nochmals über ein Jahrzehnt älter als das Unsrige.
TP: Seither hat sich das Gesundheitswesen verändert, gerade in den letzten Jahren in hohem Tempo. Spüren Sie dies auch beim Generieren von Geldern, dass bei Fragen der Gesundheit neue Themen aktuell werden und im Fokus der Öffentlichkeit stehen?
MB: Wie oben bereits beschrieben, nimmt das Fundraising für uns einen immer stärkeren Teil ein. Wir sind auch daran, einen Freundes- und Donatorenkreis der EPI zu gründen, um die immer höheren Kosten bewältigen zu können. Insgesamt nimmt die Bedeutung und Wahrnehmung der Gesundheit in der Schweiz zu. Dies heisst, dass potentielle Spender gerade Gesundheitsthemen offen gegenüber sind. Beiträge zur Forschung oder für Kinder mit Epilepsie oder auch zu unserer einzigartigen Sozialberatung für Menschen mit Epilepsie werden immer relativ grosszügig gesprochen, wofür wir sehr dankbar sind.
Gerade die Kombination und der Austausch zwischen den Medizinern und der hochstehenden Sozialberatung erachte ich als konkreten Gewinn für die Patienten.
Marco Beng, CEO der Schweizerischen Epilepsie-Stiftung
TP: Epilepsie ist in der Gesellschaft bekannt. Macht dies Ihre Arbeit einfacher?
MB: Ich finde, dass die Epilepsie, dafür, dass rund ein Prozent der Bevölkerung eine Epilepsie hat und dadurch ca. zehn Prozent der Bevölkerung über Verwandte und Freunde davon betroffen sind, zu wenig bekannt ist und dass die Epilepsie stark stigmatisiert ist. Dass es sehr viele unterschiedliche Arten von Epilepsieanfällen gibt, die meisten Menschen ohne vertieftes Epilepsie-Wissen aber nur den einen im Kopf haben, ist nicht optimal. Durch verschiedene Massnahmen versuchen wir – auch zusammen mit anderen Epilepsie-Organisationen wie der EPI-LIGA und der EPI-Suisse, die Krankheit bekannter zu machen. Und im Vergleich zu vor 10 oder 20 Jahren ist die Krankheit sicher bekannter geworden.
TP: Wie hat die Pandemie Ihre Arbeit verändert?
MB: Corona hat die Komplexität der Zusammenarbeit unter den Betrieben der EPI und auch innerhalb der einzelnen Betriebe stark erhöht. Neben der normalen täglichen Arbeit ist nun noch das Thema Corona dazu gekommen mit vielen Fragen, auf welche es zu Beginn der Pandemie – und teilweise auch heute noch – oft nur sehr unklare Antworten gab und gibt. Alle – vom Bundesrat, über das BAG, den Kantonen wie auch die Institutionen, wie zum Beispiel wir – mussten und müssen täglich dazu lernen.
TP: Sie bieten in ihrem Wohnwerk Arbeitsplätze. Ist es in der Pandemiekrise schwieriger geworden, Aufträge für diese Tätigkeiten zu erhalten?
MB: Corona hat die Auftragslage sicher nicht begünstigt, aber grundsätzlich sehen wir, dass es – auch ohne Corona – für uns schwieriger wird, Arbeiten dafür zu erhalten. Dies liegt aber vor allem am sehr hohen Schweregrad der Behinderten bei uns im EPI WohnWerk. Dies führt dazu, dass immer weniger Klienten in der Lage sind, in der Produktionswerkstatt arbeiten zu können, wo ein definierter Arbeitsprozess eingehalten werden muss. Es gab letzthin zwei oder drei Ausschreibungen. Wir waren nie konkurrenzfähig gegenüber Betrieben, welche deutlich weniger eingeschränkte Klienten haben und daher viel günstiger produzieren können. Wir sind daran, ein neues Konzept zu erstellen, wie wir mit dieser Situation umgehen wollen. Dies ist eine Erkenntnis aus dem aktuell laufenden Strategieprozess des EPI WohnWerks.
TP: Sie betreiben die grösste auf die Abklärung und Behandlung von Epilepsien und andere anfallsartige Störungen spezialisierte Klinik der Schweiz. Wo brauchen die Betroffenen heute am meisten Unterstützung, bei medizinischen oder sozialen Fragestellungen?
MB: Ich würde sagen, bei beiden Themenbereichen. Sowohl im medizinischen Bereich wie auch mit unserer Sozialberatung haben wir ein Alleinstellungsmerkmal, welches nicht von vielen anderen Kliniken erreicht wird. Dies führt dazu, dass uns Patienten aus der ganzen Schweiz aufsuchen. Nicht selten kommt es vor, dass Patienten, auch nach Jahren der Behandlung an anderen Zentren, bei uns neue Behandlungsansätze finden, welche Ihre Lebensqualität erhöhen. Auch die Tiefe der Abklärungen, das medizinische und juristische Fachwissen, spezifisch für Menschen mit Epilepsie, also die Qualität unserer Sozialberatung insgesamt, sind meiner Ansicht nach einzigartig. Gerade die Kombination und der Austausch zwischen den Medizinern und der hochstehenden Sozialberatung erachte ich als konkreten Gewinn für die Patienten.