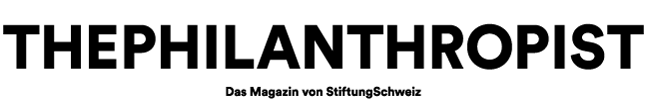The Philanthropist: Die Stiftung Institut Kinderseele Schweiz hilft Kindern von Eltern mit einer psychischer Erkrankung oder einem Suchtproblem. Wie wirkt sich die Pandemie auf diese Familien aus?
Alessandra Weber-Zimmerli: Die betroffenen Familien sind in grösserer Not als vor der Pandemie. In unseren Beratungen erlangen wir den Eindruck, dass insbesondere Familien, die vor der Pandemie bereits am kämpfen waren, durch die Pandemie ganz aus der Balance gerieten.
Beanspruchen diese Familien neu Hilfe oder waren sie schon zuvor in Beratung?
Wir begleiten Familien nur kurz bis mittelfristig. Unser Fokus liegt auf Familien, die es gerade besonders schwierig haben. Mit ihnen organisieren wir Unterstützung im privaten Umfeld oder suchen professionelle Hilfe. Sobald dies organisiert ist, ziehen wir uns zurück.
Hat sich ihre Begleitung in der Pandemie verändert?
Vor der Pandemie hatte eine Familie höchstens zwei bis drei Beratungsgespräche. Seither brauchen sie meistens mehr.
Viele betroffene Eltern meinen, sie würden ihre Kinder schützen, wenn sie nichts sagen. Doch genau das Gegenteil ist der Fall.
Alessandra Weber-Zimmerli, Institut Kinderseele Schweiz
Wie gelangen diese Familien zu Ihnen?
50 Prozent kommen von sich aus. Sie finden uns im Internet oder werden auf uns aufmerksam gemacht. 50 Prozent werden von Fachpersonen an uns verwiesen. In einem ersten Schritt beraten wir meist die Eltern.
Melden sich auch Kinder?
Kinder melden sich sehr selten. Sie sind sehr loyal ihren Eltern gegenüber, selbst wenn sie genügend selbstständig sind. Sie empfinden es als Verrat an den Eltern, wenn sie Hilfe suchen würden. Eher melden sich Tanten oder Götti.
Insgesamt sprechen Sie von 300’000 Kinder, die betroffen sind.
Da die Daten nicht erhoben werden handelt es sich um eine Schätzung, die auf Studien aus dem Ausland beruhen. Wahrscheinlich liegt die Zahl in der Schweiz mittlerweile eher bei 400 bis 450’000 betroffenen Kindern. Jedes vierte Kind ist betroffen.
Wo sollte die Forschung hier noch vertieft ansetzen?
Die Erhebung der Anzahl ist schwierig. Viele Eltern sind nicht in Behandlung. Ausserdem gibt es Erkrankungen, bei denen das Fehlen der eigenen Krankheitseinsicht zum Krankheitsbild gehört. Konkrete Zahlen zu haben, würde dem Thema politisch mehr Gewicht verleihen. Mehr Forschung wäre auch bei den Hilfsangeboten nützlich um mehr zu erfahren, welche Angebote die Kinder beim Gesundbleiben effektiv unterstützen. Hier sehe ich Potenzial.
Haben Sie konkrete Ansatzpunkte?
Viele betroffene Eltern meinen, sie würden ihre Kinder schützen, wenn sie nichts sagen. Doch genau das Gegenteil ist der Fall. Um gesund zu bleiben brauchen die Kinder Erklärungen und eine verlässliche Bezugsperson. Weitere Erkenntnisse gibt es aus Programmen in Deutschland, Norwegen und Holland. Aber es braucht noch viel Forschung um zu wissen, wie diese Programme den besten Nutzen erzielen.
Ihre Stiftung wurde 2014 gegründet. Wie hat sich die Aufgabe ihrer Stiftung seither verändert?
Die Vision ist dieselbe geblieben: Die Kinder von Eltern mit psychischer Erkrankung oder Suchtproblemen sollten nicht vergessen gehen. Sie sollen möglichst früh unterstützt werden, damit sie gesund bleiben. Ihr Risiko, selbst zu erkranken, ist zwar erhöht, aber wir wissen, dass sie es gut überstehen können, wenn sie früh Unterstützung erhalten.
Und was hat sich verändert?
Der strategische Fokus. Zu Beginn konzentrierten wir uns auf die Entstigmatisierung der psychischen Krankheit und auf die Sensibilisierung für das Thema. Unterdessen hat sich ein zweiter Schwerpunkt entwickelt: die Beratung. Wir haben seit einem Jahr eine physische Beratungsstelle nachdem wir zuvor nur über Telefon und online tätig waren. Für die Zukunft wollen wir noch verstärkt auf die Psychiatrie einwirken. Bei der Behandlung von Patienten und Patientinnen mit minderjährige Kindern soll schon früh an diese gedacht werden. Hier können wir viel erreichen.
Verändert hat sich auch, dass die Welt zunehmend digitaler wird. Ist das für Sie mehr Chance oder Herausforderung?
Für uns ist es klar ein Vorteil. Es vereinfacht die anonyme Kontaktaufnahme – es bleibt ein schambehaftetes Thema. Ausserdem können wir so in der gesamten Deutschschweiz Hilfe anbieten. Für die Gesundheit der Menschen insbesondere jene der Kinder ist die Digitalisierung aber auch eine Herausforderung.
Wenn man dem Stiftungszweck gerecht werden will, dann muss man zusammenarbeiten.
Alessandra Weber-Zimmerli, Institut Kinderssele Schweiz
Arbeiten Sie mit Partnern?
Wir arbeiten mit verschiedenen Partnerorganisationen zusammen wie Pro Juventute oder Pro Mente Sana. Da wir relativ klein sind, versuchen wir, fest mit Partnern zusammenzuarbeiten und uns so zu ergänzen.
Obschon Sie bei der Mittelbeschaffung Konkurrenten sind?
Natürlich konkurrieren wir. Aber wir machen gute Erfahrungen mit Partnerschaften. Und wenn man dem Stiftungszweck gerecht werden will, dann muss man zusammenarbeiten. Nur so kann man am meisten erreichen.
Arbeiten Sie auch mit Behörden oder Versicherern?
Behörden, Bund oder Kantone, sind als Finanzierungspartner wichtig. Mit Versicherungen haben wir kaum zu tun, auch weil unsere Angebote nicht verrechenbar sind. Das wäre natürliche eine Wunschvorstellung … Zum Teil erhalten wir einen finanziellen Zustupf von ihnen.
Mit ihrer Arbeit verhindert die Stiftung zukünftige Kosten?
Krankenversicherer müssten eigentlich ein Interesse haben, weil man weiss, dass die betroffenen Kinder ein erhöhtes Risiko haben, später selbst zu erkranken. Dem wirken wir mit unserer Arbeit entgegen. Aber dazu braucht es eine langfristige Denke, einen Zeithorizont von 20 bis 30 Jahren.
Die Weihnachtstage können für Familien herausfordernd werden. Spüren Sie dies?
Wir spüren es verzögert. Wir leisten keine Notfallhilfe. Deswegen spüren wir es im Januar, wenn die Betroffenen die Feiertage mit Mühe überstanden haben und sie aufarbeiten wollen.