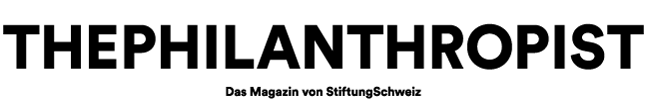Romy Krämer ist «Ship Captain» der Guerrilla Foundation. Die Stiftung in Berlin unterstützt Aktivistinnen und Aktivisten, Bürgerinitiativen und soziale Bewegungen. Sie zielt auf einen systemischen Wandel in Europa. Marlene Engelhorn ist «Radical Philanthropy Advisor» der Stiftung. Sie wird einst ein Millionenvermögen erben und hat bereits angekündigt, den Grossteil davon zu spenden.
Sie wollen die Philanthropie radikal ändern: Was ist das Problem mit der heutigen Philanthropie?
Marlene Engelhorn: Ich kann die Philanthropie nicht ändern. Es wäre Wahnsinn, wenn ich behaupten würde, ich könnte das. Aber ich würde einfach gerne diese ganze Selbstverständlichkeit, wie gegeben wird und wer überhaupt hat, hinterfragen. So wie ich es sehe, verfestigt die traditionelle Phi-lanthropie die Ungleichheit.
Was läuft falsch?
ME: Es gibt ein riesiges Machtproblem. Es ist ganz klar: Wer das Geld hat, macht die Regeln. Aber spenden ersetzt keine soziale Gerechtigkeit, keine Gerechtigkeit überhaupt. Die Philanthropie hat ein problematisches Selbstverständnis, auch weil sie geboren ist aus einer Struktur, die grundsätzlich schwierig ist, wenn es um Verteilungs- und Ungleichheitsfragen geht.
Romy Krämer: Es gibt zwei Hauptprobleme. Das erste ist die Herkunft des Geldes aus extraktivem Kapitalismus, Kolonialismus und was daran hängt. Wir müssen uns also fragen, wie wir das ändern können. Es sollte gar nicht mehr möglich sein, dass Menschen in Zukunft so unglaublich reich werden, dass sie sich als Philanthropen engagieren müssen. Das zweite sind die Praktiken, wie Philanthropie geschieht und mit welchem Ziel.
Welche Ziele sollte sie verfolgen?
RK: Philanthropie sollte versuchen, die Ursachen anzugehen.
Systemisch anzuschauen, was eigentlich die Wurzeln der Probleme sind. Diese Fragen werden sehr schnell politisch – und davor schreckt Philanthropie zurück. Stattdessen fokussiert sie auf die Symptombekämpfung. Das ist immer noch ihr Haupttätigkeitsfeld. Doch ist das eigentlich Aufgabe von Regierungen.
Aber ist Symptombekämpfung nicht die Stärke der Philanthropie? Dort aktiv zu sein, wo Wirtschaft und Staat es nicht schaffen?
RK: Diese Aussage baut auf dem Mythos auf, der Staat sei schlecht organisiert. Er wird von der Privatwirtschaft immer wieder gestreut, um irgendwann Staatsaufgaben in privatwirtschaftliche Hände zu überführen. Betrachten wir Symptombekämpfung bspw. im Bildungsbereich. Viele Stiftungen beschäftigen sich mit den Problemen, die Menschen am Übergang von Schule zu Beruf haben. Aber das sollte die Regierung machen.
ME: Diese Symptombekämpfung, diese Mangelverwaltung ist eigentlich ein Skandal. Das ist wie mit den Lebensmitteltafeln. Sie machen eine sehr wichtige Arbeit. Aber in unserer wohlhabenden Gesellschaft kann es doch nicht sein, dass wir Tafeln brauchen, weil Menschen kein Geld haben, um essen kaufen zu können. Weshalb haben sie kein Geld?
«Ich würde eher von Rückverteilung sprechen»
Marlene Engelhorn

Weshalb?
ME: Weil wir es ihnen weggenommen haben – oder weil man es ihnen nie ausgeteilt hat. Und das geschieht, weil wir ein Verständnis davon haben, dass manche Arbeiten quasi wertlos sind. Hier geht es um die Primärverteilung von Ressourcen, die schiefgegangen ist. Jetzt liegt das Kind im Brunnen. Ich kann mein Beispiel nehmen. Ich werde viel Geld erben. Ich habe es nicht verdient. Woher kommt es? Wer hat es nicht bekommen, damit ich es bekomme? Jene, die Geld haben, können sich schlecht fühlen und nichts tun oder ein gutes Gewissen kaufen. Oft geschieht dies über Stiftungen. Für mich ist es logisch, dass ich es der Struktur zurückgebe, der ich es verdanke, der Gesellschaft. Steuern wären hilfreich.
Was ist der Vorteil von Steuern?
ME: Wenn wir schon die Verteilung nicht am Anfang hinbekommen, so korrigieren wir zumindest, was hinten rauskommt. Aber diese Aufgabe gehört demokratisch geregelt. Das ist nicht Philanthropiearbeit.
Was wäre deren Aufgabe?
ME: Sie sollte in die politische Aktivität gehen. Die Menschen mobilisieren. Das ist Demokratie. Ich darf mitmachen, ich bin sogar dazu aufgefordert. Philanthropie sollte sie unterstützen. Die kleinen Projekte in der Region. Es braucht Grassroots‑, Basisbewegungen. Wir müssen nicht top-down aus Berlin erklären, was im hintersten Winkel laufen soll. Wir sollen nicht die Symptome, die überall aufscheinen, mit Geld bewerfen, bis wir sie nicht mehr sehen. Wir sollten keine Struktur erhalten, die so viel Macht bündelt, wie es in der Philanthropie leider der Fall ist.
RK: Philanthropische Organisationen sollten sich mehr mit den Rechten von Minderheiten auseinandersetzen. Sie können Gruppen sichtbar machen, die von den demokratischen Strukturen vernachlässigt werden, weil sie so klein sind. Hier ist Philanthropie wichtig, als gesellschaftlicher Regulationsmechanismus. Wir helfen Menschen, sich für ihre eigenen Rechte einzusetzen. Diese Selbstregulierung zu unterstützen, die in jeder Demokratie notwendig ist, das wäre eine Aufgabe für die Philanthropie.
Stiftungen sollen sich politisch einbringen?
RK: Jede Stiftung, die das nicht macht, ist es nicht wert, eine Stiftung zu sein. Ich meine damit nicht parteipolitische Tagespolitik. Aber ihre Ziele soll eine Stiftung auch mit politischen Mitteln umsetzen dürfen. Das ist essenziell. Jede Stiftung, die sich nicht als politischer Akteur versteht, lügt sich in die Tasche. Sie fördert einen bestimmten Zweck. Sie macht es aus einem bestimmten Grund. Das ist politisch.
ME: Sobald eine Organisation eine gewisse Grösse erreicht hat, ist ihre Tätigkeit immer in einer gewissen Weise politisch verknüpft. Viele machen dies über die Hintertür. Die Philanthropie hat die Möglichkeit, diese gemeinnützig zu organisieren und Lobbyarbeit in transparentester Art und Weise zu machen. Ich würde hinzufügen, dass die Arbeit von den Grassrootsbewegungen gemacht wird. Sie haben die Ideen, die Projekte und die Menschen. Es fehlt das Geld. Stiftungen sind Geldautomaten, aber nicht nur. Sie bieten Unterstützungsleistungen, die über das Finanzielle hinausgehen können, sie helfen beim Vernetzen.

«Vielleicht ist eine Community-Philanthorpie ein Ansatz.»
Romy Krämer
Also haben Stiftungen eine Verteilerfunktion?
ME: Nur ist das System der Verteilung marode. Mein Lieblingsbeispiel ist die Bezos-Stiftung gegen den Klimawandel. Es ist herrlich plakativ. Die Stiftung verfügt über zehn Milliarden Dollar Stiftungskapital. Das Geld ist angelegt. Am Finanzmarkt. Geparktes Geld. Es ist weg von den Steuern. Es liegt da und generiert Rendite. Doch wo liegt es? Ist es in Amazon-Aktien angelegt? In einem Konzern, der strukturell Menschen und Umwelt auf der ganzen Welt ausbeutet und vernichtet? Mit dieser Rendite wird das Problem, das man mit den Anlagen schafft, gelöst. Dieser Teufelskreis ist fast schon so absurd, dass ich ihn komisch finde. Geld ist als Schmiermittel zu verstehen, das permanent erneuert werden und im Fluss bleiben muss. Es sollte nicht abgezweigt und in Sümpfen geparkt werden.
Seine Exfrau MacKenzie Scott verfolgt einen neuen Ansatz des Spendens.
RK: Sie macht viele Sachen richtig, deren Mangel ich an der traditionellen Philanthropie kritisieren würde, wie Langzeitförderung oder die Gelder nicht an Konditionen zu knüpfen. Man könnte sie als super Beispiel für eine neue Art von Philanthropie sehen. Geht man jedoch etwas tiefer und betrachtet die absolut intransparente Entscheidungsfindung, dann zeigt sich eine Machtkonzentration, die eigentlich verboten sein sollte. Die Philanthropie sollte einen Selbstregulierungsprozess haben. Weil sie so viel Geld vergibt und das auch nicht schlecht macht, wird sie in den Medien gehypt. Die riesigen Beträge verblenden. Das Geld kommt aus der von Amazon verursachten Ausbeutung und fliesst dann in Zwecke, über die von ihr und ihren Beratern entschieden wird. Es ist ironisch, dass unter Umständen die Kinder eines Working-Poor-Amazon-Verteillager-Arbeiters, dem es verboten ist, eine Gewerkschaft zu gründen, philanthropische Bildungs- oder Gesundheitsleistungen erhalten müssen, die von MacKenzie Scott finanziert werden.
Ist es bei diesen Summen realistisch, dass sich die Philanthropie aus sich heraus erneuern kann?
ME: Wir haben ein Geldsystem. Aber wie wir damit umgehen, ist nicht so selbstverständlich, wie wir meinen. Es ist offensichtlich, dass das Geld auf eine Art verteilt wird, die massgeblich schädlich ist für die Gesellschaft, sonst hätten wir keine Working Poor. Das ist eine Katastrophe. Es wird wohl immer eine Art von Ungleichverteilung geben, aber die muss nicht hoch sein und kann durch Steuern korrigiert werden. Wir müssen uns fragen, ob die Verteilung intransparent und die Vermögen in privater Hand sein müssen, sodass wir von privatem Wohlwollen abhängig sind. Philanthropie muss verstehen, was ihre Rolle in der Verteilungsfrage ist.
Und die wäre?
ME: Ihr eigentliches Ziel muss sein, auf die eigene Abschaffung hinzuarbeiten, hin zu zivilgesellschaftlichen Engagements, die auf breiter Ebene funktionieren. In diesen wird transparent mit öffentlichen Geldern umgegangen.
Dann braucht es in einer idealen Gesellschaft keine Philanthropie?
ME: Was ist eine ideale Gesellschaft?
Eine Gesellschaft, in der die Ungleichheiten zumindest minimiert wurden.
ME: Ist das dann ideal? Was die Frage beinhaltet: Was ist unsere Utopie von gesellschaftlichem Zusammenleben, regional oder global? Worum geht es? Warum gruppieren sich Menschen in diesen grossen Gesellschaften, in denen sie einander nicht mehr kennen und sich organisieren müssen? Dafür braucht es ja dann Politik und öffentliche Geldverwaltung. Diesen Fragen müssen wir uns stellen und sie mit den Fragen verknüpfen, woher das Geld kommt, wohin es gehen soll und wer das entscheiden darf. So können wir uns gemeinschaftlich einer Utopie und dem, was wir dazu brauchen, annähern.
RK: Das gute Leben für alle. Wie sieht das überhaupt aus? Wer kann dazu beitragen, auf welche Art und Weise? Vielleicht ist eine Community-Philanthropie ein Ansatz.
Wie funktioniert diese?
RK: Eine Community kommt zusammen. Sie haben mehr, als sie brauchen. Das werfen sie in einen Topf und bestimmen, was sie unterstützen wollen. Vielleicht ist eine junge Person in der Community, die sich künstlerisch betätigen will, und alle wollen sie mit einem Grundgehalt unterstützen. Es läuft über Beziehungen. Es ist transparent. Dies würde dem Begriff der Philanthropie näher kommen.
ME: Eine gute Freundin hat den Begriff des idealen philanthropischen Gebens als Lagerfeuer beschrieben. Man kommt zusammen, bespricht sich, leistet Beziehungsarbeit, lässt die Ideen über Nacht wirken und am nächsten morgen – bildlich gesprochen – beginnt die gemeinsame Arbeit. So gelingt es, das Ungleichgewicht gemeinsam zu lösen. Wir müssen auch jenen, die Macht abgeben und das nicht wollen, eine gesichtswahrende Möglichkeit bieten, die Macht ohne Bedeutungsverlust abzugeben. Bedeutungsverlust bringt Menschen dazu, sich an Macht zu klammern. Das hat mit Status zu tun. Wer bin ich in der Gesellschaft? Wer sich nicht über seine Macht definieren muss, dem fällt es nicht schwer, diese aufzugeben.
RK: Es gibt verschiedene Initiativen in der Philanthropie, die darüber nachdenken, ob es nicht eine neue Bezeichnung braucht, wenn man Philanthropie anders machen will. Junge wollen vielleicht anders spenden als ihre Eltern. Sie wollen keine Stiftung gründen. Vielleicht braucht es ein neues Wort, das bezeichnet, was an Umverteilung passiert, aber das nicht so politisch konnotiert ist – oder vielleicht sollte es das gerade sein.
ME: Ich würde eher von Rückverteilung sprechen statt Umverteilung.
RK: Es sind aber nicht nur die Jüngeren. Es kommen immer mehr Impulse von Menschen, die in der Philanthropie arbeiten. Sie sehen, dass vieles schiefläuft. Sie suchen eine Community. Es läuft viel in Europa mit Participatory Grantmaking, dem Einbezug der betroffenen Community in die Verteilentscheidung, und Power Sharing, dem Teilen von Macht. Hier läuft viel.
Wie offen erleben Sie die Philanthropie für die neuen Ansätzen? Schon der Name Guerrilla Foundation dürfte provozieren?
RK: Das ist nur unser Markenname. Wir durften die Stiftung in Deutschland nicht unter diesem Namen anmelden. Der Richter, der die Eintragung beim Handelsgericht vornehmen sollte, lehnte dies ab. Er assoziierte ihn mit Gewalt. Dabei gibt es bereits andere Unternehmen bspw. im Marketing, die mit diesem Namen registriert sind.
Und wie offen ist der Sektor?
RK: Wir erfahren mehr Zuspruch, als wir bedienen können. Das Interesse ist gross.
ME: Wenn ich sage, was ich mache, ist das Interesse riesig. Die Menschen sehen, da gibt es etwas, das funktioniert. Es hat zum Teil auch eine Mentalität dahinter, die ich schwierig finde: Gib mir die Antwort. Dann denke ich: Setze dich doch damit auseinander.
RK: Aber es gibt eine kritische Masse an Menschen, die in der Philanthropie für Erneuerung sorgen können. Deswegen habe ich auch die Hoffnung, dass sich aus dem Sektor etwas ändern kann. Aber das Problem ist, dass die Entscheidungsmacht oft an der falschen Stelle ist.
ME: Das ist ein wichtiger Punkt. Es gibt ganz viele Menschen, die in diesen Stiftungen die Stiftungsarbeit machen. Diese sind meist reguläre Angestellte. Und es gibt jene, die das Geld in eine Stiftung geben und mit einem Aufsichtsratsposten die Entscheidungsgewalt haben, aber weit weg sind. Hier geht es um Geld und Eigentum. Gebe ich Eigentum, muss ich eigentlich auch die ganze Entscheidungsgewalt abgeben. Deswegen haben wir das auch mit Vertragszeremonien ritualisiert. Das ist bei Geld nicht anders. Aber oft ist es mit einem Anspruch verbunden. Ich gebe dir dieses Geld, aber mache damit das, so wie ich es will. Bei Stiftungen ist es ähnlich. Sie geben Stiftungsgeld für die Arbeit an eine Gruppe und dann wird ihnen noch mitgeteilt, wie sie es machen sollen. Deswegen sollten wir in der öffentlichen Debatte diskutieren, was bedeutet eigentlich Eigentum. In Deutschland ist es ganz klar: Eigentum verpflichtet. Im Grundgesetz folgt der Satz, den ich so genial finde und der selten zitiert wird: Der Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Das bedeutet, das Geld soll im Fluss sein, es soll aktiv sein.
RK: In diese Richtung spielt der Gedanke des Impact Measurement. Stiftungen übertragen quasi die Arbeit zu dokumentieren und zu messen zusätzlich zum Geld dem Empfänger. Der Grundgedanke, dass man wissen will, wie viel Gutes man geschaffen hat, ist verständlich. Aber der Ansatz, der aus dem Entwicklungssektor kommt, funktioniert eigentlich nur dort, wo die Phi-lanthropie nicht aktiv sein sollte. Will ich aber bspw. die Menschen befähigen, ihre Rechte einzufordern, kann ich das nicht messen. Ich habe 5000 Menschen an einer Demonstration. Hat das mehr gebracht, als wenn 300 Menschen drei Wochen im Hungerstreik sind? Das kann ich nie messen.
ME: Es zeigt einen rigiden Kontrollzwang der Mächtigen, rückwirkend zu kontrollieren, was passiert ist.
Was wäre der bessere Ansatz?
RK: Es wäre interessant darüber nachzudenken, Gruppen Geld zu geben, weil einen das überzeugt, was sie bis jetzt erreicht haben und welche Werte und Ziele der Arbeit zugrunde liegen. Wenn die Förderstrategie sich auf die Menschen konzentriert, die direkt von Problemen betroffen sind, haben wir mit der Mittelvergabe schon mal Geld umverteilt. Wenn die Gruppe dann mit dem Geld zusätzlich noch politisch wirksam sein kann, super, dann freue ich mich. Dann bekomme ich noch etwas Zusätzliches!