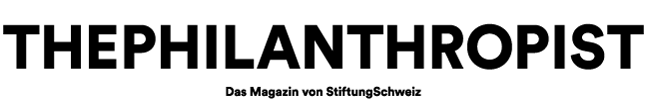Eine Stiftung für das soziale Engagement, ein Unternehmen für die wirtschaftlichen Aspekte: Mit einem ganzheitlichen Ansatz fördert die bioRe Stiftung Biolandbau in Indien und Tansania.
«Wir haben schnell gemerkt, dass wir die Frauen im Biolandbau schulen müssen», sagt Christa Suter, Geschäftsführerin der bioRe Stiftung. Diese fördert den biologischen Anbau von Baumwolle. Bei den ersten Schulungen in Indien erschienen jeweils die registrierten Bauern und somit die Männer. Dies erwies sich als wenig zielführend: «In indischen Familien verrichten die Frauen oft landwirtschaftliche Arbeit und sie übernehmen die Aufgaben im Haus. Das heisst nicht, dass die Männer nicht arbeiten. Sie haben andere Aufgaben. So sind sie etwa für die Bewässerung zuständig.» Um effektiv zu wirken, musste die Stiftung die Frauen erreichen. Gemischte Lerngruppen sind aus kulturellen Gründen nicht möglich. So sind die heute über 80 Frauengruppen entstanden. In diesen lernen sie bspw., wie sie mit Präparaten aus Knoblauch, Zwiebeln oder Chili Schädlinge biologisch bekämpfen. In den Schulungen erfahren die Frauen nicht nur das Wie, sondern auch das Warum. Dieses Wissen sorgt für eine kompetente Umsetzung. «Die Idee ist, dass Frauen das Wissen weitervermitteln. 800 Frauen sind es unterdessen. 2021 sollen es 1000 werden», so Christa Suter.
Mehr als Ressourcengewinnung

Den Grundstein für bioRe in Indien legte Patrick Hohmann vor 30 Jahren. Der Stiftungsgründer und heutige Ehrenpräsident des Stiftungsrates lancierte 1991 ein Projekt für den Anbau von Biobaumwolle. 1994 folgte die Gründung des Projektes in Tansania. Die Projekte waren seit Anbeginn geprägt vom Grundgedanken, die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung mit dem sozialen Aspekt zu verknüpfen. Waren zu Beginn die sozialen Engagements im normalen Geschäftsbetrieb integriert, zeigte sich bald, dass dies zu komplex geworden war. Eine Stiftung als Trägerin des sozialen Engagements schien die ideale Form. 1997 gründeten Remei und Coop die bioRe Stiftung. Diese Lösung hat den Vorteil, dass das Engagement nicht vom Geschäftsgang abhängig ist. «Alle wirtschaftlichen Aktivitäten rund um das Produkt bleiben im Unternehmen Remei gebündelt. Die bioRe Stiftung kümmert sich dagegen um das Soziale und die Gemeinschaft», sagt Christa Suter. Trotz dieser organisatorischen Aufteilung bleibt die Stiftung elementarer Bestandteil des Biobaumwollprojektes.


Auf Bedürfnisse reagieren
Der ganzheitliche Ansatz ist ein wichtiger Erfolgsfaktor der Stiftung. So unterstützt sie nur Projekte, die aus der Gemeinschaft heraus formuliert wurden. «Die Stiftung reagiert auf Bedürfnisse. Ein Impuls aus der Gemeinschaft löst die Projekte aus», sagt Christa Suter. Zu den auf diese Weise erfolgreich lancierten Projekten gehören die Saatgutforschung und die Schulen. Die Problemstellung ist der Kern der Engagements. «Wir wollten nicht 18 Schulhäuser bauen, sondern Schulbildung ermöglichen.» Der Impuls kam von einem Bauern. Die Kinder wurden in seiner Stube zusammengeführt, um mit einem Schulalltag zu beginnen. Dabei ging es um ganz rudimentäre Dinge: den Kindern zeigen, was Schule ist, dass sie gepflegt erscheinen und dass sie ihre Schulsachen mit dabei haben. Das war Basisarbeit, um das Thema der Bildung überhaupt in die Gemeinschaft zu bringen. Heute liegt ein Augenmerk auf der Qualität der Schulbildung. Dabei versteht sich die Stiftung nicht als Konkurrenz zum Staat. «Wir haben auch schon Schulen geschlossen, nachdem in der Nähe eine staatliche Institution eröffnet worden war», sagt Christa Suter. Aktuell besuchen 1261 Kinder die Animationsschulen, 694 Jungen und 567 Mädchen. «Es ist eine Investition in die selbstbestimmte Zukunft der Mädchen, dessen sind sich die Mütter bewusst», betont Xenia Ritter, die Kommunikationsbeauftragte von bioRe. Die Stiftung hat auch geholfen, die sanitäre Situation für die Frauen zu verbessern. In den ländlichen Regionen Indiens ist diese oft ungenügend. Teils fehlen Toiletten ganz. Staatliche Projekte mit finanzierten Gemeinschaftstoiletten scheiterten. Christa Suter erzählt: «So hatten uns die Männer berichtet, dass sie gerne Toiletten zum Schutz ihrer Frauen wollten.» Uns war klar, dass diese unmittelbar neben dem Wohnhaus sein mussten. Dies gewährte Sicherheit und gab den Frauen die Möglichkeit für Privatsphäre, gerade wenn sie ihre Tage hatten. Ausserdem garantierte diese Lösung, dass sich jemand für das WC verantwortlich fühlte und dieses reinigte.