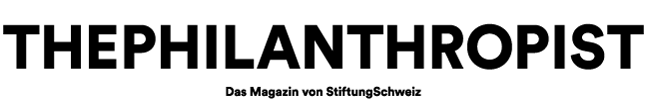The Philanthropist: Sie mussten 2009 wegen des Irakkriegs aus Ihrer Heimat fliehen. Haben sie den Moment der Flucht kommen sehen?
Aya Abdullah: Ich war damals 14 Jahre alt. Wir hörten die Bomben. Wir sahen Menschen sterben. Trotzdem kam die Flucht für mich überraschend. Meine Eltern hatten sich darauf vorbereitet. Um uns nicht zu verängstigen haben sie uns aber im Voraus nichts erzählt.
TP: Was war das Schlimmste?
AA: Wie gesagt, für mich kam es überraschend. Ich habe sogar noch mein Mathebuch mitgenommen; für die Schule am nächsten Tag. Das Schlimmste war, die Schule, meine Freundinnen und Lehrer zu verlassen.
TP: Hatten Sie danach noch Kontakt?
AA: Sich nicht verabschieden zu können war hart. Aber aus Sicherheitsgründen wusste niemand davon. Wir hatten keinen Kontakt mehr.
TP: Was vermissen Sie am meisten?
AA: Zwei Dinge: In unserem Haus im Irak hatten wir einen Garten. Am Nachmittag, wenn sich die Sonne senkte – Sie müssen wissen, die Sonne im Irak ist wirklich heiss – wenn sich also die Sonne senkte, kamen alle Kinder der Nachbarschaft zusammen. Es waren verschiedene Ethnien und Religionen. Erst auf der Flucht realisierte ich das. Damals war das kein Thema. Wir lebten zusammen in Frieden, wir spielten im Garten. Dieses Gefühl, das Zusammensein, das gemeinsame Essen, das fehlt mir wirklich. Und das Zweite, das ich vermisse, ist der Geruch des Bodens, wenn es regnet. Ich erzähle das jeder Person. Und glauben Sie mir, es gibt diesen Duft im Irak, der ist einzigartig und ich vermisse ihn. Ich lebte auf der Flucht in zwei anderen Ländern. Aber dieser Geruch des Bodens, wenn es regnet im Irak, das gibt es in keinem Land.
Die äusseren Umstände machten mich zum Opfer. Das wollte ich ändern.
Aya Abdullah
TP: Sie flohen nach Syrien, später in die Türkei. Gab es auch positive Erfahrungen?
AA: Das Leben in den beiden Ländern war sehr unterschiedlich. Ich kam über Nacht nach Syrien. Aber es gab kulturelle Ähnlichkeiten und ich konnte mit den Menschen sprechen. Wir haben uns registriert. Wir konnten in die Schule. Wir mussten uns den Umständen anpassen. Aber wir konnten das Leben fortsetzen.
TP: Und dann mussten Sie auch aus Syrien in die Türkei fliehen?
AA: Hier war das Leben komplett anders. Es war eine völlig andere Kultur, eine unbekannte Sprache. Als Teenager begriff ich, was es wirklich heisst, Flüchtling zu sein, was mir weggenommen wurde. Ich verstand, was mein Status für meine Ausbildung und meine Menschenrechte bedeutete. Wenn wir über positive Erfahrungen sprechen wollen: Was dich nicht umbringt, macht dich stärker. Daran glaube ich ganz stark. Ich wurde stärker. Ich arbeitete für das UNHCR. Ich arbeitete mit anderen Flüchtlingen. Die äusseren Umstände machten mich zum Opfer. Das wollte ich ändern. Ich wollte eine Leader sein. Die Menschen sollen mich nicht nur als Opfer sehen und Mitleid haben. Sie sollen nicht nur die negative Seite kennen lernen.
TP: Welche Unterstützung half Ihnen am meisten?
AA: Das UNHCR hat uns von Anfang an zusammen mit verschiedenen NGOs und Partnern geholfen. Auch die Regierungen waren hilfreich um uns Sicherheit zu geben. Aber vielen Flüchtlingen fehlt das Wissen von diesen NGOs. Sie kennen ihre Rechte nicht. UNHCR hat uns bereits bei der ersten Registrierung 2009 in Syrien begleitet. Sie sind auch der Grund, dass wir heute zusammen mit unserem Vater hier in der Schweiz an einem sicheren Ort leben. Dafür bin ich sehr dankbar.
TP: Können Sie im Alltag das Thema Flucht vergessen und ein normales Leben führen?
AA: Ich bin ein Flüchtling. Das ist ein Teil von mir. Ich versuche nicht, das zu vergessen, sondern zu akzeptieren. Aber natürlich bin ich noch immer exponiert, gerade wenn Menschen meinen Flüchtlingsausweis sehen. Ich habe Angst vor der Zukunft. Ich frage mich: Wenn ich mein Studium abgeschlossen haben werde und mich um eine Stelle bewerbe, werde ich aufgrund von meinem Abschluss bewertet oder einfach aufgrund meines Aufenthaltstatus?
Dieses Gefühl, das Zusammensein, das gemeinsame Essen, das fehlt mir wirklich.
Aya Abdullah
TP: War Bildung für Sie auf der Flucht ein Thema?
AA: Das wichtigste war natürlich unsere Sicherheit. Aber Bildung ist für mich zentral. Für Flüchtlinge ist es wahrscheinlich noch von grösserer Bedeutung. Heute sind 70 Millionen Menschen auf der Flucht. Die Hälfte davon ist unter 18 Jahren. Wir sprechen von einer Generation, die ihre Zukunft verliert, wenn wir ihnen keine Chance auf eine Ausbildung geben können. Nur so können sie ihr Trauma überwinden, sich eine Chance für eine Zukunft aufbauen. Dabei geht es nicht nur um Primarschulen. Es braucht Mittel- und Oberstufen und auch Universitäten. Viele Flüchtlinge können ihre Ausbildung nicht abschliessen, sei es aufgrund eines Konflikts, sei es weil ihnen ein Papier aus der Heimat fehlt.
TP: Welche Bedeutung hat der Ausweis für Sie?
AA: Als ich in der Schweiz die Ausweispapiere als Flüchtling erhielt musste ich weinen. Es war das erste Mal, dass ich einen Ausweis erhielt, mit dem ich über eine Grenze konnte, ohne gestoppt zu werden. Wer nie auf der Flucht war, stattdessen im Land aufwachsen kann, in dem er geboren wurde kann vielleicht nicht nachvollziehen, wie das ist, wenn man sich nicht frei bewegen kann.
TP: Haben sich Ihre Erwartungen, vielleicht auch Träume, in der Schweiz erfüllt?
AA: Für viele Flüchtlinge, die hören, dass sie in ein sicheres Land können, ist dies der Himmel. Dies gilt speziell für die Schweiz. Wir kannten natürlich die Schweiz aus der Werbung. Aber als Flüchtling ist die Situation ganz anders als wenn jemand als Touristin oder zum Arbeiten kommt. Den ersten Hindernissen begegnete ich an der Universität, als man mich nicht zulassen wollte. Es fehlten mir Papiere. Ich war wieder am Nullpunkt. Ich musste mich entscheiden: Aufgeben oder einen anderen Weg finden. Dieses Land bietet dir so viele Möglichkeiten. Aber sie kommen nicht zu dir. Du musst dich dafür einsetzen, hart arbeiten. Es ist eine ehrgeizige Gesellschaft. Nun bin ich das vierte Jahr hier. Ich werde an der Universität abschliessen, vielleicht besser als erhofft. Ich bin als Präsidentin in einer NGO engagiert. Ich kann sagen: Der Schweizer Traum lebt. Ich bin der Schweiz extrem dankbar, dass sie mir und meiner Familie eine sichere Zuflucht geboten hat.
TP: Konnten Sie hier so etwas wie ein normales Leben erreichen?
AA: Ich glaube, ich werde kein normales Leben haben, bis ich das Gefühl habe, dazuzugehören und integriert zu sein. Dazu gehören die entsprechenden Papiere, die mir das Gefühl geben, dass ich ganz sicher bin in diesem Land, dass mich niemand vertreiben kann. Ein 100 prozentig normales Leben habe ich nicht. Aber ich versuche, mich zu integrieren so weit es geht, produktiv zu sein für dieses Land um zu zeigen, wie dankbar dass ich bin.